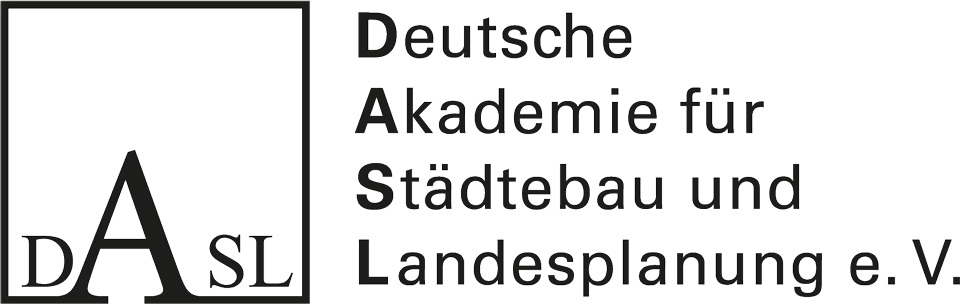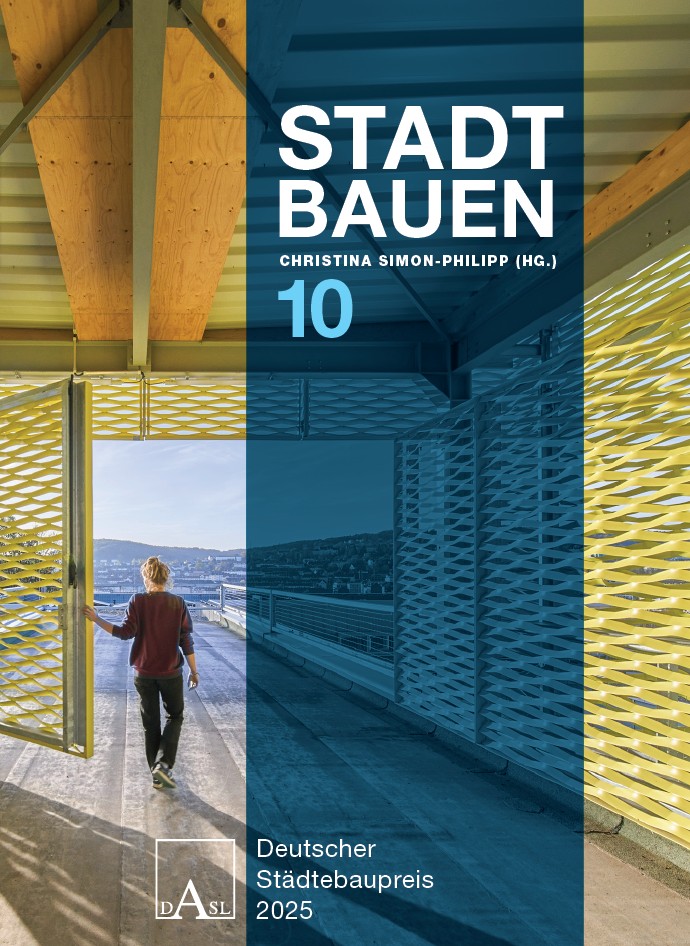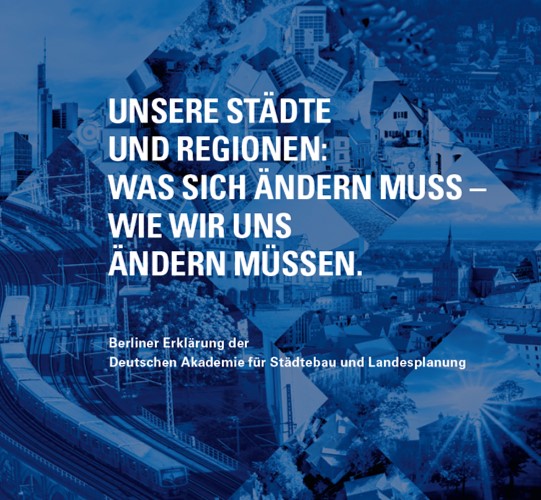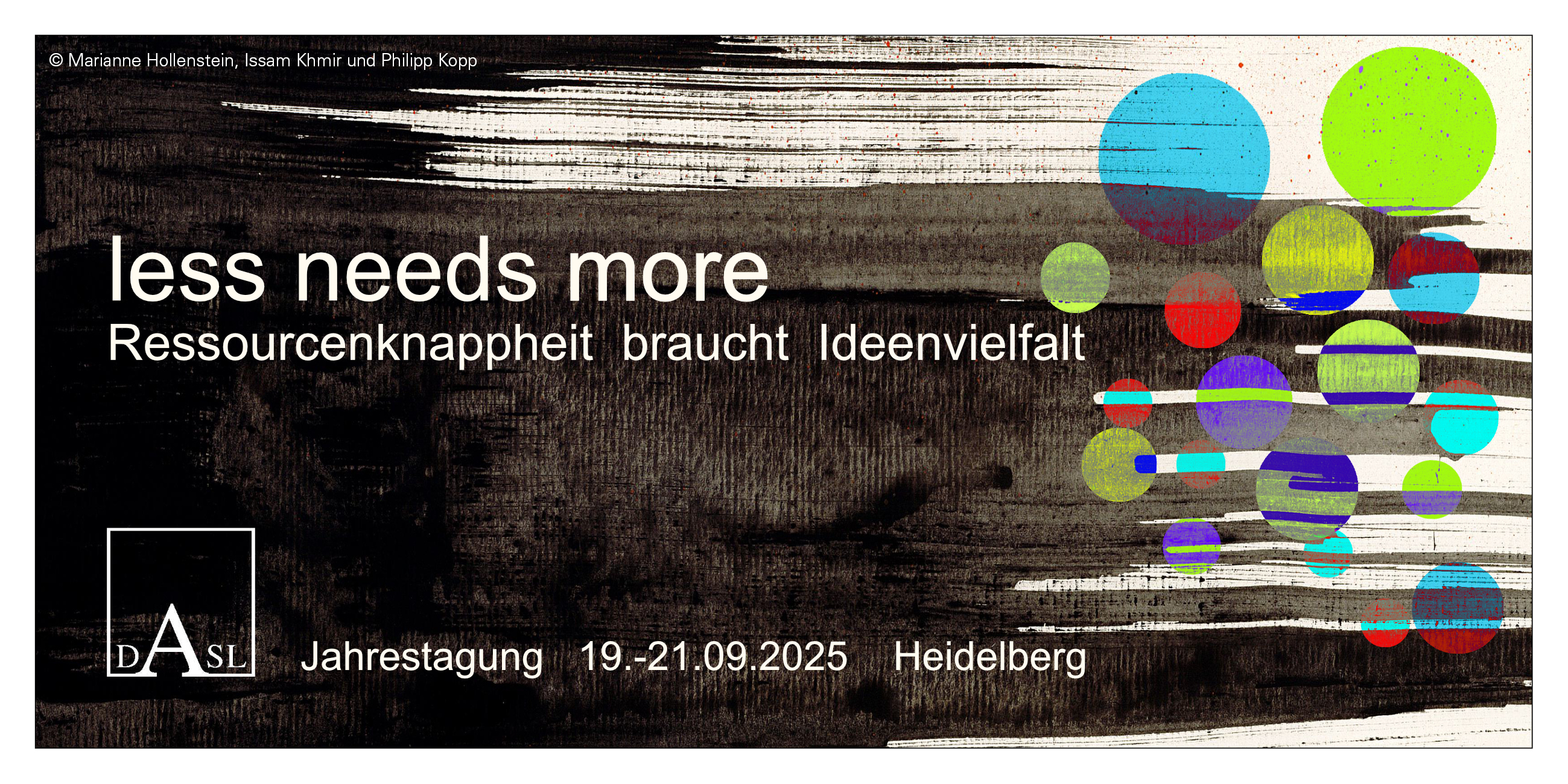Kurzer Bericht zum Umsetzungslabor des Bauturbo am 10. Dezember 2025 in der KINDL-Brauerei, Berlin
Am 10. November 2025 fand in Berlin und online eine umfassende Debatte zu den aktuellen Änderungen im BauGB – dem Bauturbo – statt. Mario Tvrtković, Erik Wolfram und Frauke Burgdorff, sowie andere Mitglieder der DASL und der Institute, waren vor Ort und möchten ihre Eindrücke mit den DASL-Mitgliedern und weiteren Interessierten teilen.
Die Teilnehmenden äußerten sich einhellig und begeistert: Es ist neu, dass ein Gesetz intensiv von kommunalen Praktikern beleuchtet, mit dem Ministerium direkt und auf Augenhöhe diskutiert und dieses Ereignis auch noch professionell moderiert wird.
Bedauerlich ist jedoch, dass diese Diskussion erst nach Inkrafttreten des Gesetzes stattfindet und nicht zwischen Beschluss und Inkrafttreten. Die Kommunen müssen nun schnell Grundsatzbeschlüsse fassen, Prozesse anpassen und Routinen ändern. Das Ministerium gibt hier erfahrenen Handwerkern neue Werkzeuge an die Hand, mit denen sie sofort – ohne Einführung – arbeiten sollen. Auch die Gebrauchsanweisung müssen sie leider selbst schreiben.
Glücklicherweise haben der Städtetag, einige Städte sowie Stadtstaaten bereits vorgearbeitet, sodass der Übergang nicht völlig unvorbereitet erfolgt.
Das hybride Format zwischen dem Kesselhaus der ehemaligen KINDL-Brauerei und dem digitalen Raum erreichte etwa 1.500 Menschen. Die Auftaktdebatte mit der Ministerin und den Oberbürgermeistern von Kiel und Eltville erfüllte die Erwartungen. Es gab viel Motivation, etwas zu viel Bürokratiekritik und konkrete Hinweise auf die Ambitionen des Bauturbos, wie Klimaanpassung und Umbau von Patrick Kunkel. Ulf Kämpfer ermutigte dazu, die kommunale Arbeit mit einem "Ja, wenn" statt einem "Ja, aber" anzugehen. Er betonte jedoch auch, dass angesichts der Wohnungsknappheit die Stadtästhetik nicht mehr im Vordergrund stehen könne. Dabei sind doch viele von uns durchaus in der Lage, Geschwindigkeit und Baukultur zu vereinen, und daran sollten wir festhalten.
In der anschließenden Runde wurden die Chancen der BauGB-Änderungen vertieft. Frau Dungs von der Greyfield Gruppe betonte, dass große Umbauprojekte selten am BauGB scheitern und dass respektvoller Umgang mit kommunalen Stellen und ausreichende Zeit entscheidend sind. Abteilungsleiter Horn wies darauf hin, dass diese kleine Novelle nur der Anfang sei und dass bald eine weitere BauGB-Novelle folgen werde, die unter anderem die Bürgerbeteiligung und die Volldigitalisierung vorantreiben soll. Wir setzen darauf, dass dies Praktikerinnen, wie die eloquent die kommunale Ebene vertretende Claudia Warnecke aus Paderborn sowie natürlich mit den Erfahrungen der Städtetagskollegen um Hilmar von Lojweski verbunden wird.
Die hoch professionell organisierte und moderierte Veranstaltung öffnete anschließend Foren zu den drängenden Fragen: Welchen Rahmen brauchen die neuen gesetzlichen Regelungen? Welche Grundsatzbeschlüsse und Spielregeln sind nötig? Wie müssen kommunale Prozesse angepasst werden? Was ist die Zustimmung der Gemeinde und wer gibt sie?
Umfassende Antworten werden hoffentlich bald auf den Internetseiten des BMWBS und des Deutschen Städtetages zu finden sein. Wir beschränken uns hier auf wenig Highlights, die die Bedeutung der BauGB-Novelle für die Planungs- und Baukultur betreffen.
Befreiung als Chance für alte Bebauungspläne:
Die Erweiterung der Befreiungsmöglichkeiten im § 31 für das Wohnen wurde als große Chance für Stadtumbau und Nachverdichtung bewertet. Besonders Bebauungspläne aus den 60er und 70er Jahren können nun maßvoll nachverdichtet werden. Insbesondere bei Gewerbegebieten bergen die neuen Möglichkeiten aber auch das Risiko einer Entwicklung, die zugunsten neuer Wohnungen wirtschaftliche Entwicklungspotenziale opfern könnte.
Fragen zur Öffnung des § 34:
Das Maß der baulichen Nutzungen nicht mehr beachten zu müssen, klingt für die Ministerin wie ein Versprechen. Für andere birgt es Unsicherheit. Entspricht ein Vorhaben den „Vorstellungen der Gemeinde von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung“ – und wer entscheidet das? Wie können nachbarliche Belange mit den Erwartungen der Antragstellenden in Einklang gebracht werden? Wie verhält sich die planungsrechtliche Zustimmung im Vorbescheid zur späteren Baugenehmigung? Vielleicht sind es am Ende die kleinen Erleichterungen, die diese Änderung bewirken.
Offenheit für und Kritik am § 246 e:
Projekte, die auf § 246 e rekurrieren, betreffen wahrscheinlich den planerischen Außenbereich und mithin auch Umweltbelange. Besonders ländliche Kommunen äußerten große Sorge, dass die Zustimmung der Gemeinde ohne eine wenigsten überschlägige Bewertung öffentlicher und Umweltbelange stattfinden könne. Auch die Frage, ob mehr Baugenehmigungen, falls diese kommen, wirklich einen Beitrag zu bezahlbarem und leistbarem Wohnen leisten, bleibt offen – werden die Sickereffekte eintreten; kann vermieden werden, dass der Bauturbo ein Grundstücksverwertungsturbo wird? Auf Kommunaler Ebene wird und muss sich zeigen, ob hier die Möglichkeit der Gemeinde, die Zustimmung mit Bedingungen zu verknüpfen, genutzt wird. Ebenfalls ist klar, dass die im Prozess vorgesehenen Fristen von 3+1 Monaten, keinen Zeitraum für ernsthafte Beteiligung und Mitwirkung eröffnen und eine echte Herausforderung für Verwaltungsabläufe (und ggf. nötige Entscheidungen durch die Politik) bedeuten.
Die Zustimmung der Gemeinde – Stärkung und Verantwortung kommunaler Perspektiven:
Der neue § 36 a bildet die Basis für einen neuen Prozess. Die Zustimmung der Gemeinde ist Voraussetzung für die Anwendung der neuen Paragraphen. Doch wer ist die Gemeinde? Welche Ausschüsse und Gremien sind zuständig? Was passiert mit kommunalen Satzungen im Energie- oder Grünbereich? Es wird gerade bei größeren Städten darum gehen, die Zuständigkeiten zwischen Verwaltung und Politik so zu gestalten, dass zügige Entscheidungen möglich werden, ohne dass die Zustimmungsfiktion eintritt. Es besteht Hoffnung, dass viele Vorhabenträger das Gespräch mit den Kommunen suchen, bevor die Frist des § 36 a beginnt. Einige Kommunen, darunter Potsdam und Herne, haben ihre Ansätze vorgestellt und nützliche Beiträge zur Debatte geliefert. Andere Kommunen – hier insbesondere die ländlichen – habend dringend darum gebeten, dass das Ministerium so schnell wie möglich Handreichungen zur Verfügung stellt, damit die lokalen Gemeinden ihre Zustimmung(en) oder Ablehnung(en) gut ausgewogen und rechtssicher geben können.
Und nun?
Wir sind gespannt, wie sich das Umsetzungslabor für den Bauturbo weiterentwickeln wird. Die eigenwillige Mischung der Initiatoren (Bauwendeallianz des projecttogether in Kooperation mit BMWBS und difu) hat sich als segensreich erwiesen. Wir hoffen, dass das Lernen nicht nur in den Kommunen stattfindet, sondern auch das Parlament und das Ministerium die Änderungen des BauGB sorgfältig und zügig in den Umsetzungsdialog einbringen. Denn am Ende ist alles nichts ohne die Praxis der Investierenden, der Kommunalpolitik, der Stadtplaner und Bauämter vor Ort.
Autoren: Frauke Burgdorff, Mario Tvrtković, Erik Wolfram