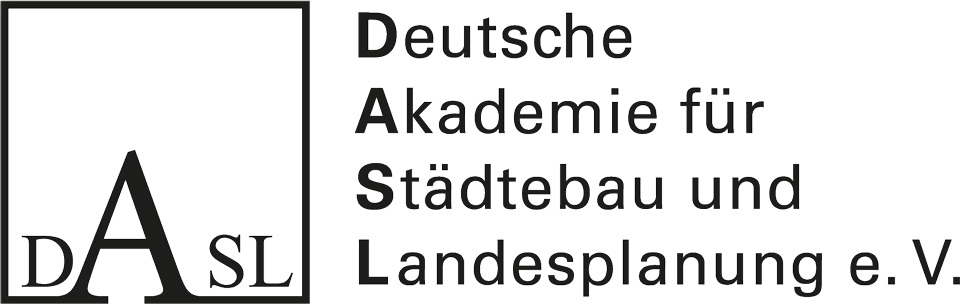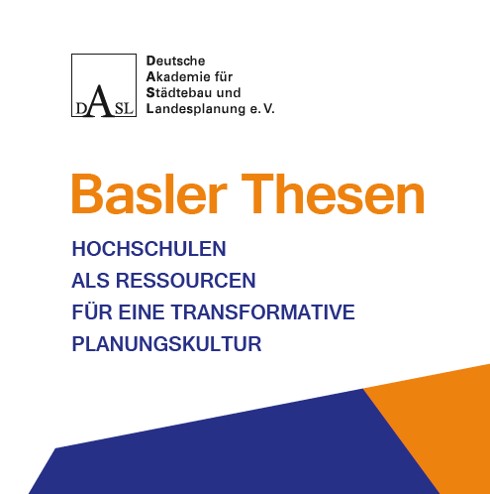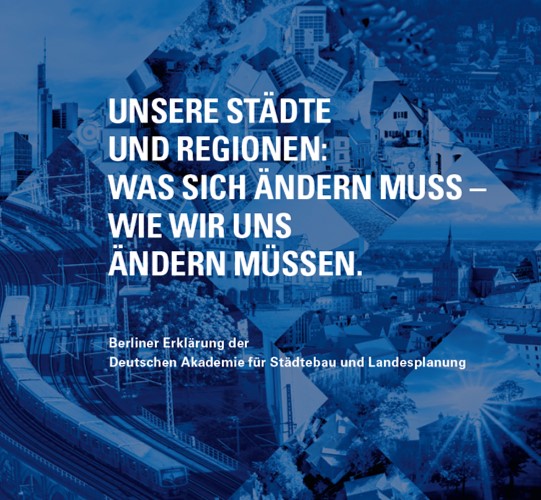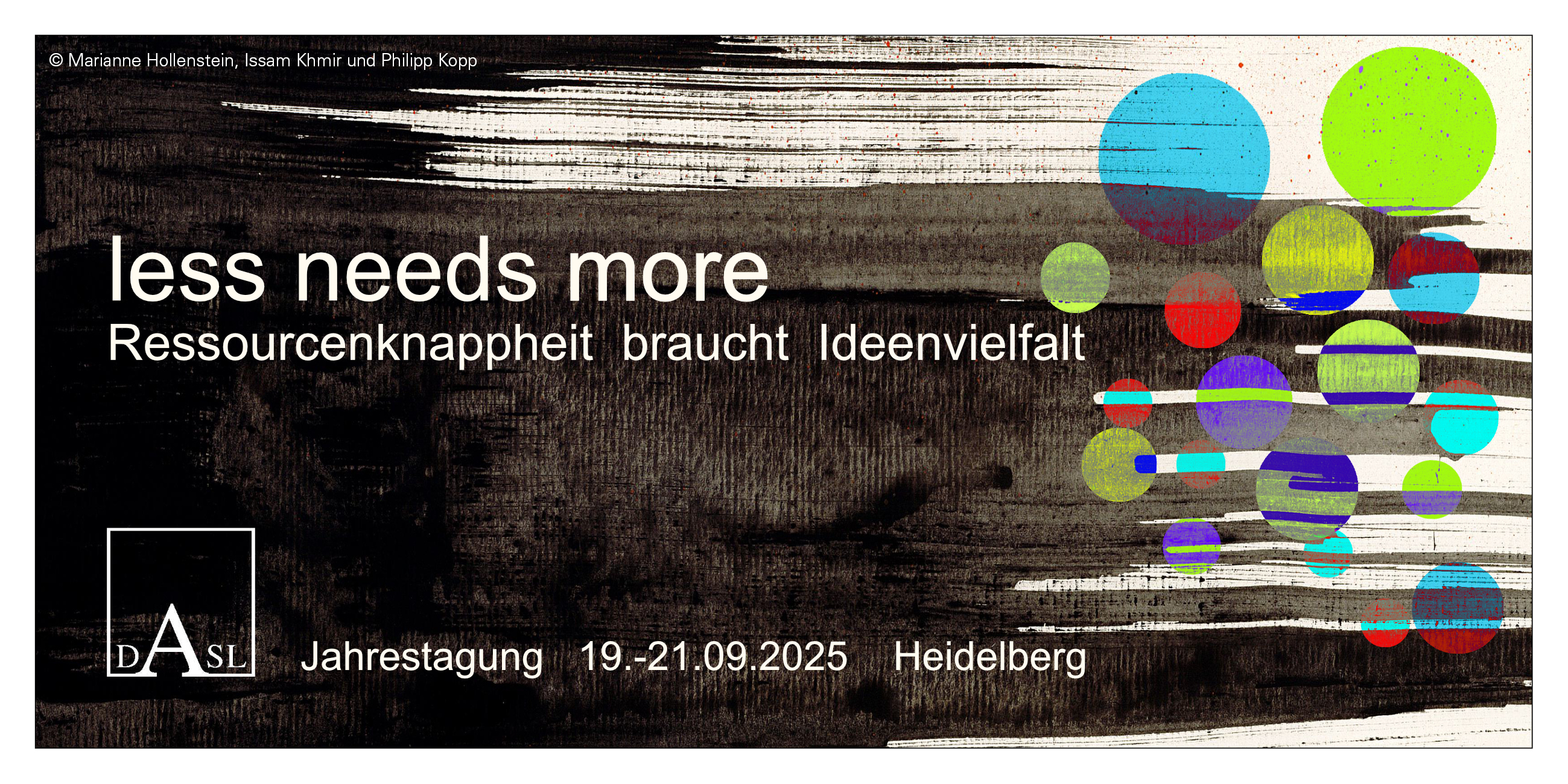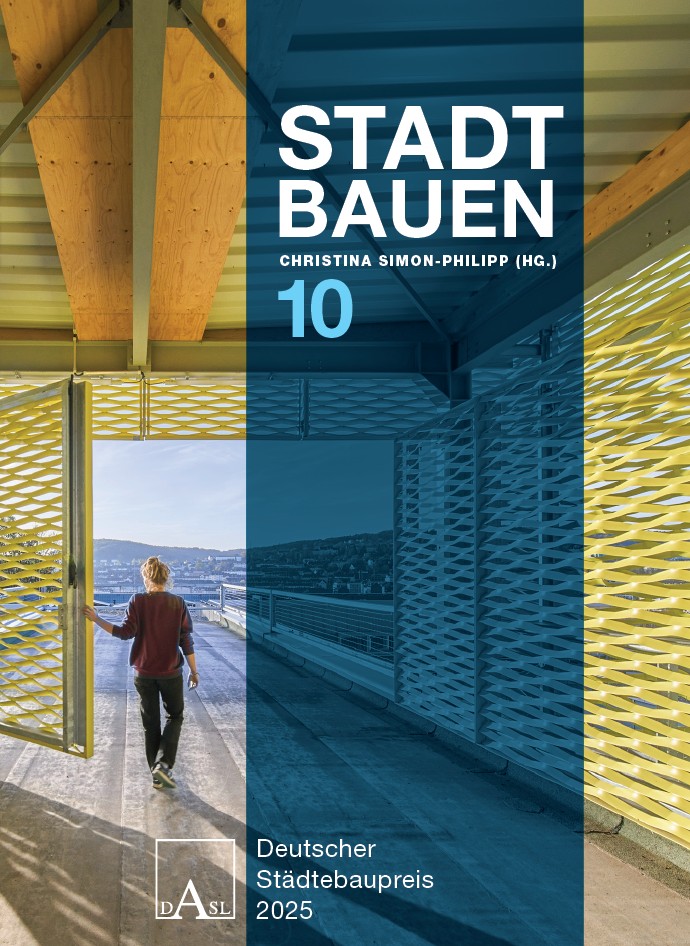Der steigende Flächenverbrauch erfordert neue Strategien für eine nachhaltige Nachverdichtung bestehender Siedlungen. Ein Forschungsprojekt an der TU Graz entwickelt dafür einen alternativen Ansatz, der Bestandserhalt, höhere Dichte und Umweltverträglichkeit verbindet.
Autor: Prof. Dr. Matthias Castorph
TU Graz, Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege (EnBeDe)
24. September 2025
Fragestellung:
Vor dem Hintergrund des steigenden Flächenverbrauchs sind neue, wirkungsvolle Nachverdichtungsstrategien notwendig. In den Fokus rücken dabei Siedlungen mit Einfamilienhäusern, die (nicht nur) in Österreich mehr als 2/3 des Gebäudebestands ausmachen. Diese Bauform weist aufgrund geringer Dichte einen besonders hohen Flächenverbrauch pro Wohneinheit auf. Besonders EFH aus den 1970er- und 1980er-Jahren bieten Potenzial: Sie befinden sich oft in gut erschlossenen Lagen, stehen entweder leer oder vor einem Generationswechsel und weisen häufig bauliche Mängel auf, die ohnehin Sanierungen erfordern bzw. stehen auf Grundstücken, die immobilienwirtschaftlich nicht ausgenutzt sind, was dann zu Abriss und Neubau auf vergrößerten Grundflächen führt.
Bestehende Nachverdichtungskonzepte umfassen unter anderem Anbauten, Aufstockungen oder Neubauten. Sie stoßen jedoch an ihre Grenzen: Entweder wird der Bestand erhalten, was ökologisch vorteilhaft, aber für die Flächenerhöhung wenig effektiv ist, oder die Verdichtung erfordert Abriss und Neubau, was zu zusätzlichen Emissionen, Verlust von grauer Energie und zusätzlicher Versiegelung führt.
Daher suchen wir einen alternativen Ansatz, der Bestandserhalt, hohe Dichte und Umweltverträglichkeit verbindet. Lässt sich durch eine nur vertikale Nachverdichtung eine substanzielle Aufstockung bestehender EFH realisieren? Wie kann die Nutzfläche ohne Neuversiegelung deutlich erhöht werden? Wie erhält man dadurch gewachsenen Grünraum und spart zudem graue Energie durch Bestandserhalt?
Hintergrund:
Der zunehmende Flächenverbrauch stellt eine der zentralen Herausforderungen einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung dar. Um das Ziel eines Netto-Null-Flächenverbrauchs bis 2050 – wie von der EU angestrebt – zu erreichen, müssen neue Strategien zur Siedlungsentwicklung erarbeitet werden, da ein genereller Baustopp als radikale Maßnahme zwar theoretisch wirksam wäre, jedoch – insbesondere in urbanen und stadtnahen Lagen – nicht umsetzbar ist. So erscheint die Nachverdichtung in bestehenden Siedlungsstrukturen, bei Ausnutzung bestehender Infrastrukturen, ein grundsätzlicher Ansatz zu sein, um Neuversiegelungen zu vermeiden.
Nachverdichtungsansätze:
Für die Nachverdichtung von EFH-Siedlungen liegen zahlreiche Studien und etablierte Ansätze vor, bei denen das Potenzial ergänzender Neubauten durch An- und Zubauten, Umnutzungen oder minimalinvasive Aufstockungen, sowie die Folgen von Abriss und großflächigem Neubau untersucht wurden. Zudem wurden veränderte Nutzungsorganisationen von Einfamilienhäusern untersucht, die die Ausnutzung des Bestands erhöhen.
Dabei zeigt sich ein grundlegendes Dilemma, wenn die Dichte erhöht werden soll: Sollen die Veränderungen minimal sein, so erhält man möglichst viel Bestand und erweitert die Grundfläche möglichst nicht. Dies ist jedoch mit nur geringem baulichen Verdichtungspotenzial verbunden, da sich das Erweiterungspotenzial zumeist in kleinen Ergänzungen, Umbauten und Aufstockungen auf dem 1. Obergeschoßes erschöpft, was die Dichteerhöhung auf ca. 50% limitiert.

Beobachtet man dagegen die Ansätze mit maximalen Veränderungen, so sieht man, dass nach dem Abriss des Bestands (bei Verlust der grauen Energie) wesentlich größere Gebäude entstehen, die die heute möglichen größeren Baufelder (festgesetzt durch aktuelle Abstandsflächenregeln bzw. aktualisierte Bebauungspläne) in der Fläche ausnutzen und sich damit der Fußabdruck der Neubauten vergrößert. Durch die Abgrabungen für die neuen, größeren Keller und den zum Teil nun notwendigen Tiefgaragen wird das Grundstück zudem großflächig ausgeräumt und damit die über die letzten Jahrzehnte entstandene Grünstruktur zerstört.
Wie könnte man trotzdem signifikant verdichten, beispielsweise die Nutzfläche verdoppeln, ohne weiter zu versiegeln?
Hier setzt das laufende Forschungsprojekt am Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege (EnBeDe) an der TU Graz unter der Leitung von Dr. Svenja Hollstein an, das eine alternative bauliche Nachverdichtungsstrategie verfolgt:
Nach Rückbau des oberirdischen Bestands bleibt nur noch das Kellergeschoß mit Kellerdecke erhalten. Die Keller, die meist überdimensioniert und statisch belastungsfähiger sind, als im Bestand notwendig war, bilden nun die Basis für 4(-5) geschossige Neubauten (z.B. Holzleichtbauweise), die einen neuen Typus für individuelle Wohnformen bilden können. Dieser ist nun frei von den Zwängen des früheren Grundrisses (z.B. Lage und Größe der Treppe, fehlender Aufzug zur Barrierefreiheit) und kann auf die veränderten Nutzungsgewohnheiten (kleinere Wohneinheiten, andere soziale Modelle etc. reagieren). So lassen sich z.B. auf Maisonette-Grundrissen auch Atriumgrundrisse stapeln, so dass einerseits ungestörte private Freiflächen im Garten und andererseits in den Wohnungen entstehen, die den bestehenden Nutzungsformen der bisherigen Einfamilienhäuser fast adäquat sein können.

Im Kern der Überlegungen steht dabei, wie eine Lösung aussieht, die die Wünsche und Interessen der Grundeigentümer ernst nimmt und sie bei den Veränderungen „abholt“.
Daher bleibt das Vorhaben auf das individuelle Grundstück zugeschnitten und die Entscheidungen bleiben den jeweiligen Eigentümern überlassen, was Zeitpunkt, Ausführung und individuelle Gestaltung etc. angeht.
Technisch erscheint das Vorhaben überschaubar, da z.B. notwendige Verbesserungen des Baugrunds durch den Keller durchgeführt werden könnten, ohne dass die darüber liegende Baustruktur stört, und es kann auf bewährte Konstruktionsmethoden zurückgegriffen werden. Ebenso kann die Infrastruktur (Hausanschluss etc.) weiterverwendet werden.
Dieses einfache Vorgehen, dass technisch und typologisch kaum Probleme aufwirft, stellt in Bezug auf die Ressourcen eine Option dar: Weniger Erhalt des Gebäudes (nur Erhalt des Kellers anstelle von Keller und Erdgeschoß/ Teilerhalt Dachgeschoß) ermöglicht deutlich mehr Nachverdichtung, ohne den Fußabdruck zur vergrößern und kann die eingewachsenen Grünstruktur besser erhalten und auch die dann resultierende vergrößerte Oberfläche der Gebäudehülle ist durch die nachweislich verbesserte Belichtungssituation der Gebäude insgesamt akzeptabel.
Jedoch stößt die Idee an verschiedene andere Schwierigkeiten: Baurechtlich sind kompakte und höhere Baustrukturen in EFH-Gebieten bisher kaum vorgesehen und das durch die Punkthäuser entstehende Quartiersbild ist noch ungewohnt. Hier könnte die Diskussion sowohl bei den Planungsbeteiligten und Eigentümern ansetzen, ob die offensichtlichen Vorteile bzgl. Nachhaltigkeit, Belichtung, Nutzung und geringerem Flächenverbrauch im Gegensatz zu den gängigen Verfahren der Nachverdichtung durch Grundflächenvergrößerung, die Vorurteile und Veränderungsängste überwiegen könnten. Für die Realisierung interessiert zum einen die Akzeptanz der Eigentümer und die baurechtliche Umsetzbarkeit im Rahmen bestehender und möglicher zukünftiger öffentlich-rechtlicher Regelwerke. Zum anderen stellt sich aber auch die Frage, wie die heutigen Anforderungen an Stellplätze verändert werden müssten, die zu den oberirdischen Duplexgaragen und neuen Tiefgaragen auf den Grundstücken bei üblichen Nachverdichtungen führen. Ob dies durch Reduzierung des privaten Fahrzeugbestands z.B. durch verbesserte ÖPNV-Angebote oder durch eine effizientere Nutzung von Straßen- und Vorgartenflächen möglich ist, ist eine weitere Forschungsfrage in Erweiterung der laufenden Überlegungen.
Im Ergebnis wird unsere Forschung hoffentlich ein weiterer Baustein sein, das beschriebene Problem anzugehen, Flächenverbrauch zu reduzieren, Grünbestand zu erhalten und das Bild der Stadt in seinen Randgebieten nachhaltig weiterzuentwickeln.