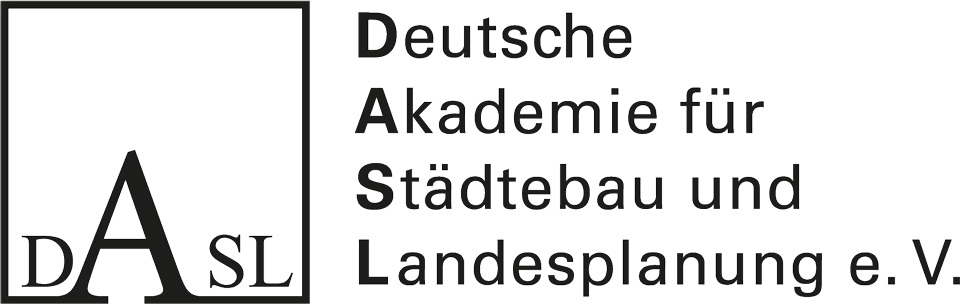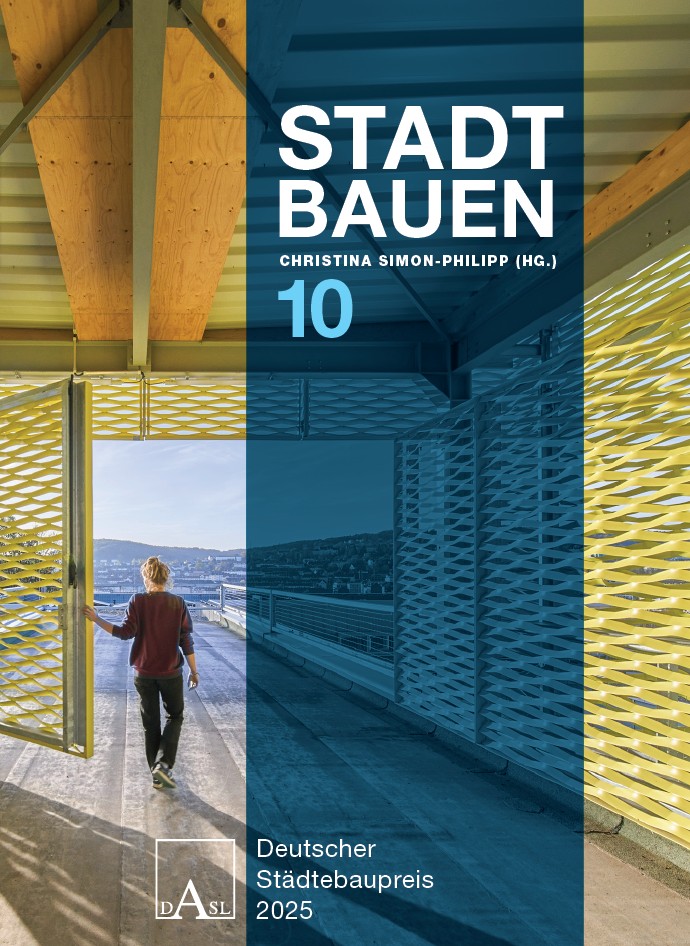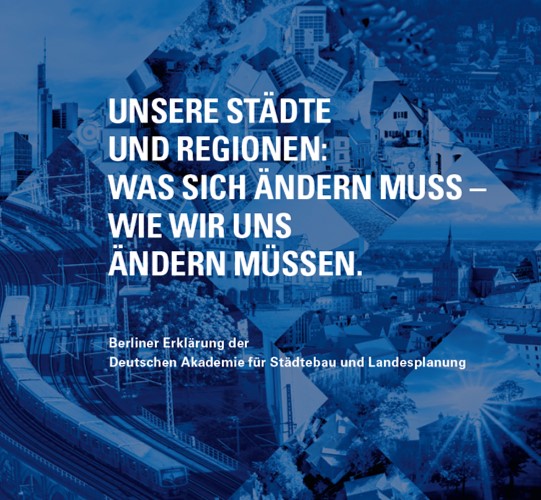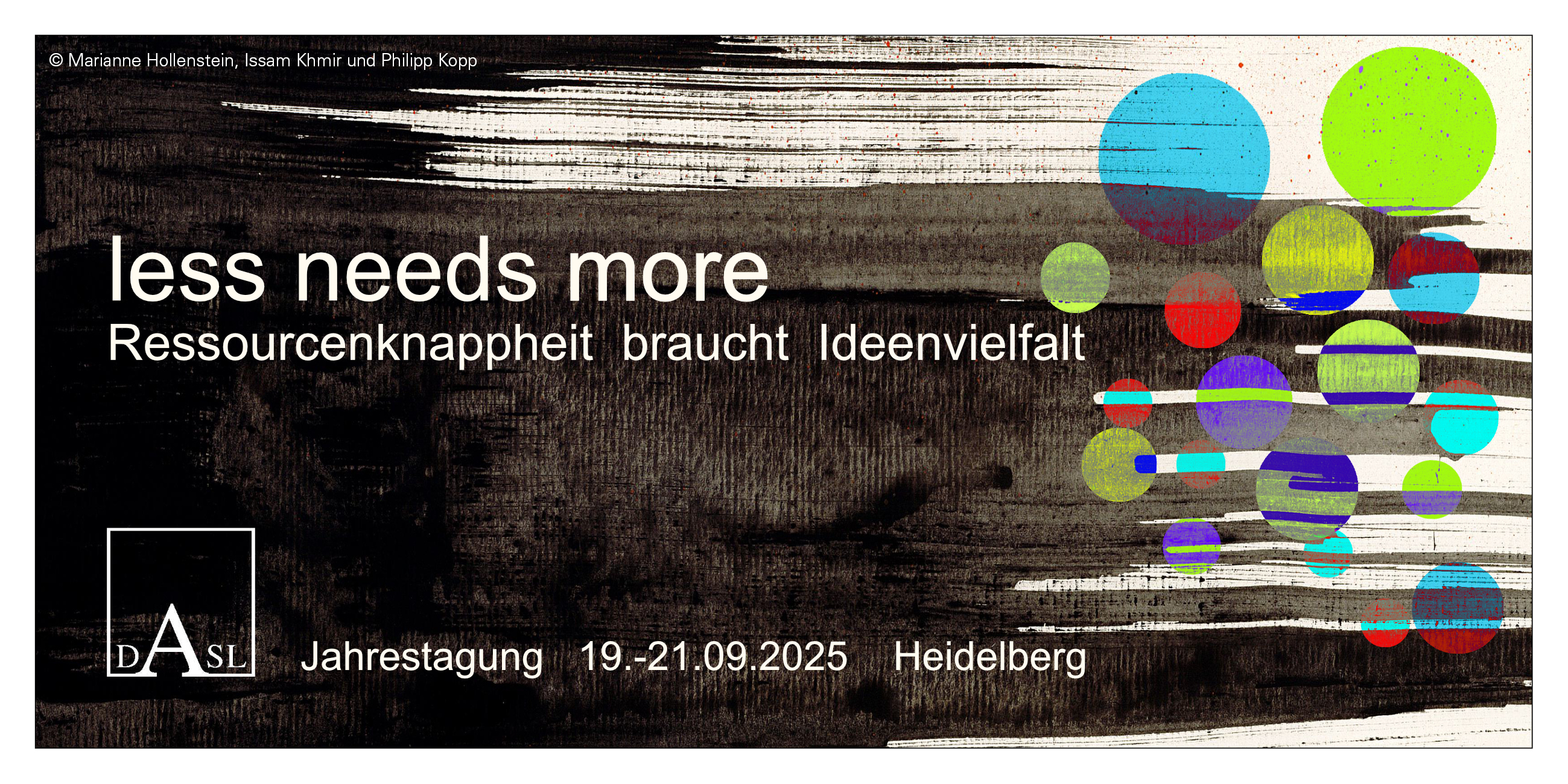DASL LG B/BB, Thesen zur JT 2025 in Heidelberg
Thesenpapier zur Diskussion in der Fishbowl-Runde
Berlin-Brandenburg illustriert beispielhaft, wie politisches Handeln durch einen konzeptionellen Antagonismus zwischen Stadt und Land geprägt ist. Kontextspezifische Faktoren wie die Westberliner Insellage in einem geteilten Deutschland oder die heutigen Grenzen der Bundesländer Berlin und Brandenburg verstärkten Entwicklungen, deren Wurzeln in der deterministischen Moderne und ihrer Forderung nach räumlicher Funktionsteilung zu suchen sind: die Entflechtung von Produktions- und Konsumsystemen sowie die Entflechtung von verbrauchsorientierten Stadtökonomien von den sie umgebenden natürlichen Ökosystemen. So wurden Städte zu Laboren der Überflussgesellschaft und ihrer extraktiven, Konsum und Müll produzierenden Logiken. Bis heute dominiert ein Wirtschaftssystem, dass sowohl die Anfälligkeit als auch den potenziellen Nutzen von Ökosystemleistungen in seiner Kosten-Nutzen-Analyse ignoriert und die Auswirkungen seines extraktiven Verhaltens externalisiert hat. Die Folgen der resultierenden Klima-, Ressourcen- und Biodiversitätskrise sind nicht nur in Siedlungskernen spürbar, sondern auch in der Fragilität der industriellen Forst- und Landwirtschaft.
Eine Voraussetzung für eine sozialökologisch auskömmlichere Entwicklung in planetaren Grenzen ist die Überwindung des Stadt-Land-Antagonismus in Köpfen und Handlungsmustern. Anstatt fragmentierter, sektoraler Ansätze könnten die synergetische Ko-Transformation von Stadt und Land zu Win-Win-Situationen führen. Anstatt Stadt und Land als Gegensatz zu begreifen, sollten menschliche Siedlungsräume eines Post-Anthropozäns als Teil von den sie umgebenden und durchdringenden Ökosystemen und natürlichen Kontexten betrachtet werden, das heißt als Teil eines räumlichen Gesamtsystems mit (begrenzt) verfügbaren materiellen Ressourcen und Stoffströmen, in die wir eingebettet und von denen wir abhängig sind. Anstatt diesem System fortwährend Ressourcen zu entziehen (Extraktivismus) und es durch Abfall zu belasten, muss unser Handeln in Zukunft auf die Restabilisierung und Stärkung der Mensch-Natur-Verflechtungen ausgerichtet sein, also einen positiven bzw. „regenerativen“ Beitrag leisten. Existierende (raum)planerische Instrumente sind derzeit nicht ausreichend, um in der notwendigen Schnelligkeit ein Umdenken zur Überwindung dieses Antagonismus zwischen Stadt und Land zu befördern.
Zwei Beispiele illustrieren die Chancen eines Umdenkens:
(1) Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten für bio- und geobasierte Bauprodukte als Katalysatoren für ein klima- und kreislaufgerechte Transformation von Stadt und Land
Der Bausektor ist einer der größten THG-Emittenten, Ressourcenverbraucher und Abfallproduzenten. Die „Bau-Wende“ benötigt neben der Wiederverwendung von Baustoffen und Bauteilen auch eine „Baustoff-Wende“. Durch einen weitgehenden Ersatz von Stahl, Beton und Kunststoff durch natürliche und nachwachsende Baustoffe wie Lehm, Schilfgras, Holz etc. aus der Region könnten Wertschöpfungsketten entstehen, die Finanzierungsgrundlagen für Reparatur von biodiversen, Wasser- und C02 speichernden Landschaften (Waldumbau, Wiedervernässung von Mooren usw.) schaffen, als auch die materiellen Grundlagen für einen klima- und kreislaufgerechten Siedlungsumbau ermöglichen. Neben langlebigen, C02 einlagernden Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft bieten Landschaften vielfältige Ressourcen: Agroforst-Systeme für Konstruktionshölzer, Schilfkulturen für Dämmmaterialien, Lehmentnahmestellen mit anschließender Renaturierung oder Hanf- und Flachsanbau für Naturfaserdämmung. Auch landwirtschaftliche Abfälle wie Stroh können in skalierbare, vielfältig einsetzbare Bauprodukte verwandelt werden. Die Abschätzung der Potentiale nachhaltig erzeugbarer Baustoffe in der Region B/BB zeigt die Möglichkeit hoher regionaler Bedarfsdeckung. Der Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten zur Nutzung der Potentiale erfordert eine bessere Akteurs-Kooperation und Änderungen im rechtlich -institutionellen Rahmen.
(2) Strategisches Kompensationsmanagement
Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Kern des Metropolraumes Berlin-Brandenburg sind begrenzt oder suboptimal nutzbar. Ein gemeinsames regionales Kompensationsmanagement könnte die Zuordnung von Flächen und Maßnahmen optimieren und zur Stärkung der Natur und ihrer Ökosystemleistungen in der gesamten Region beitragen. Großflächige, länderübergreifende Kompensationsmaßnahmen können zu deutlich besseren ökologischen Ergebnissen führen als kleinteilige Einzelmaßnahmen. Durch die Bündelung von Einzelmaßnahmen können größere landschaftliche Defiziträume durch umfassende Leitprojekte gezielt aufgewertet werden. Kompensationsmaßnahmen können auch als strategische Hebel fungieren, um regionale Wertschöpfungsketten für nachhaltige Baustoffe aufzubauen. Die Berliner Stadtgüter in Brandenburg oder das Freiraum-Verbundsystem des LEP B/BB bieten eine geeignete Gebietskulisse für die Anwendung überregionaler Ausgleichsmaßnahmen. Es entstehen Win-Win-Situationen für alle Akteure: Kommunen werden vom „Alltagsgeschäft" der Entwicklung, Umsetzung und Pflege entlastet, Landschaftsentwicklung wird großräumig koordiniert, und regionale Entwicklungsziele können integriert werden.
Die größte Herausforderung liegt in der Verknüpfung unterschiedlicher Rechtssysteme zwischen Berlin und Brandenburg. Während das Bundesnaturschutzgesetz räumlich getrennte Kompensation grundsätzlich ermöglicht, schränken Ländergesetze dies ein. Die Harmonisierung verschiedener Bewertungsverfahren stellt ein weiteres zentrales Problem dar – bisher haben sich nur die doppelte Buchführung oder die Festlegung auf ein gemeinsames Verfahren als praktikabel erwiesen.
Erfolgsvoraussetzungen und Lösungsansätze
Das Gelingen länderübergreifender Partnerschaften hängt davon ab, ob die relevanten Akteure aus gemeinsamen Aufgaben gemeinsame Lösungen entwickeln können, Lasten und Nutzen ausgeglichen verteilt sind und verbindliche Regeln akzeptiert werden. Passende Organisationsformen entstehen i.d.R. „bottop-up“ aufbauend auf vorhandenen Strukturen. Erfolgreiche Beispiele wie das Städtequartett Damme-Diepholz-Lohne-Vechta oder der Grüne Ring Leipzig zeigen, dass interkommunale Kooperation funktionieren kann, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen und alle Beteiligten einen Mehrwert erkennen.
Ohne Vision und klare Ziele kein Konzept, ohne Konzept kein Anstoß zum Handeln. In Zeiten von „Transformationsmüdigkeit" und eines drohenden Roll-Backs zu überholten Sichtweisen und Planungsansätzen müssen aber die herkömmlichen Planungsansätze und Tools überprüft und ergänzt werden.
Berlin/Potsdam 12.9.2025 Manuela Hahn, Friedemann Kunst, Gregor Langenbrinck, Philip Misselwitz