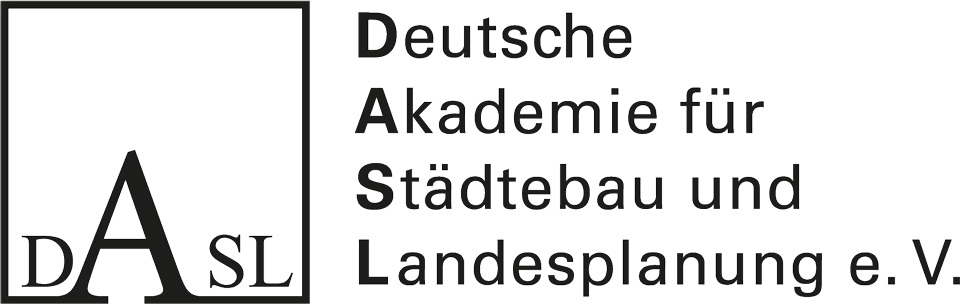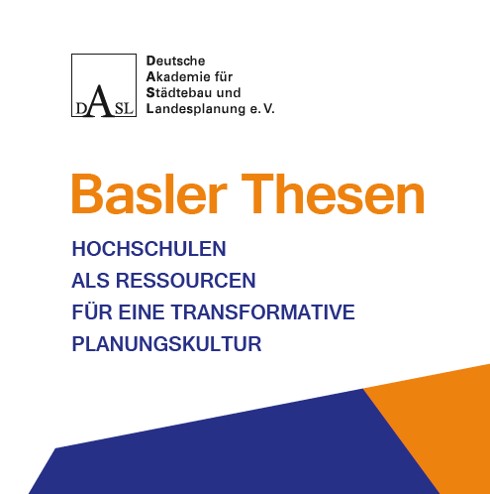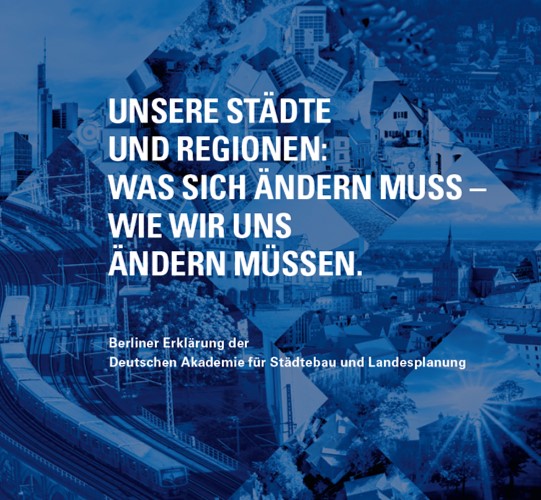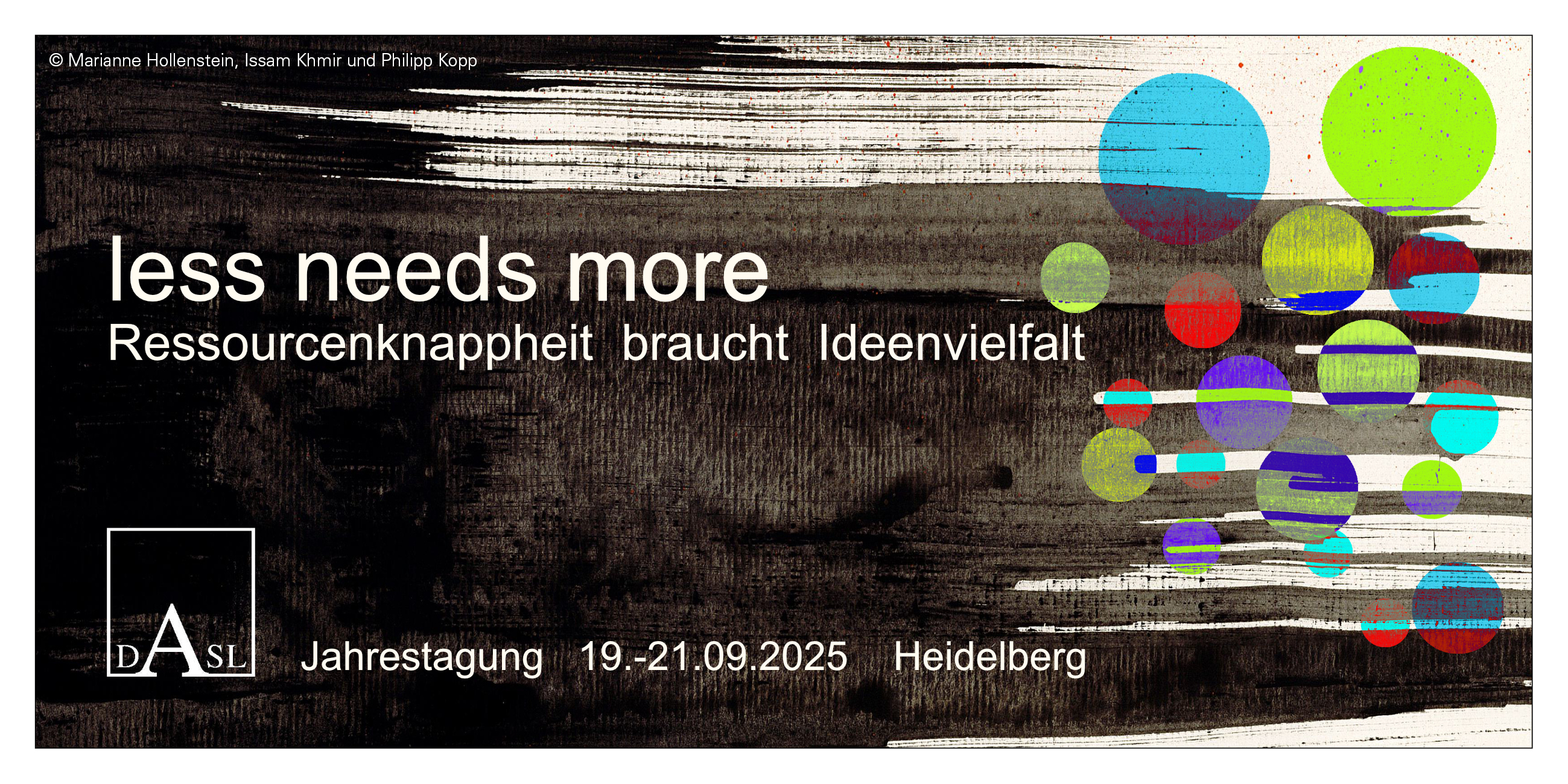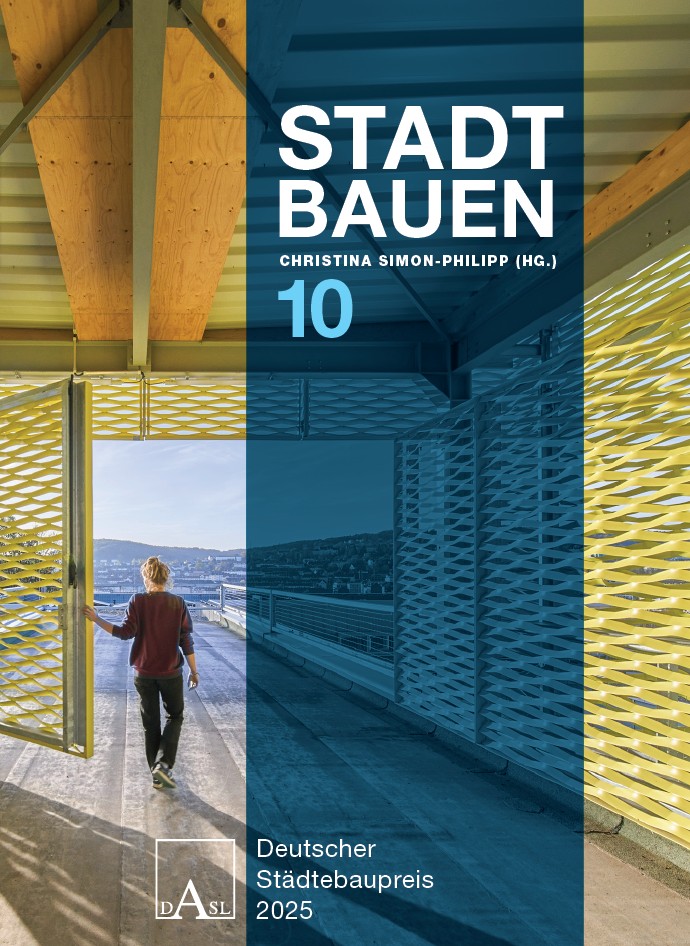Im Artikel geht es um eine suffiziente Wohnraumversorgung und Reduzierung des Fläschenverbrauchs unter Berücksichtigung ökonomischer Regelungspraktiken durch Abbau schädlicher Subventionen. Stetiger Wohnungsneubau führt zu stetigem Fläschenverbrauch, von welchem insbesondere die wohlhabenden Bevölkerungsschichten profitieren. Daher wird die These vertreten, dass zumindest für alles, was den CO²-Verbrauch erhöht und de Flächenverbrauch steigert Kostenwahrheit geschaffen werden muss - soziale Härten müssen durch Subjektförderung ausgeglichen werden. Weiter Instrumente wie Wohnungstausch Management, Leerstandsmanagement solle so ausgestattet werden, dass Wohnraum zu verträglicher Preisen aktiviert werden kann.
Autor: Dip. Ing. Reinhard Schier
Mitglied Landesgruppe Nord
15. September 2025
Suffiziente Wohnraumversorgung
Die räumliche Planung spielt bislang keine ausreichende Rolle bei der Gestaltung von Prozessen in Richtung Nachhaltigkeit. Der Flächenverbrauch geht unvermindert weiter und der CO²-Ausstoß wird nicht im erforderlichen Umfang reduziert. Die CO²-Reduzierung durch bessere Dämmung und/ oder veränderte Heiztechniken der Gebäude wird durch den Zuwachs an Wohnfläche konterkariert. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Umsetzung kann nur verringert werden, wenn auch die richtigen Stellschrauben gesucht und gefunden werden.
Die Bevölkerung beklagt den Wohnungsmangel, die hohen Bau- u. Mietkosten, die Energiekosten. Gleichzeitig nimmt die Wohnfläche pro Einwohner weiter zu und die Zahl der Bewohner pro Wohneinheit ab. Durch stetigen Zubau von Wohnungen wird das Problem der Mangelversorgung bei dem unteren Drittel der Bevölkerung nicht gelöst, da der Zuwachs an Wohnfläche durch die stetige Nachfrage der wohlhabenderen oberen beiden Drittel aufgesogen wird.
Zentrale Fragestellung müsste sein, wie die aufgrund des gesellschaftlichen Wohlstands potenziell unbegrenzte Nachfrage nach Wohnraum beschränkt werden kann. Diese Entwicklung müsste durch systemimmanente Rahmensetzungen ohne großen zusätzlichen Verwaltungsaufwand in Gang gesetzt werden und langfristig dauerhaft wirken. Diese Wandel ist komplex und aufwändig, aber zwingend notwendig.
Das wichtigste Instrument wäre Kostenwahrheit: Alles, was schädlich ist, muss teuer sein, auch die Bau- und Heizkosten. Eine undifferenzierte sachorientierte Subventionierung dämpft die erwartbaren steuernden Effekte. Staatliche Unterstützung dürfen nur die Bedürftigen erhalten. Dafür wäre in wesentlich höherem Maße die Subventionen auf personenbezogene Subventionen umzuwandeln und dafür auch sicher die untere Mittelschicht stärker mit einzubeziehen - ein Systemwandel, der sicher nicht ohne Schwierigkeiten zu meistern sein wird. Aber nur so kann eine Transparenz in bezug zu einer Kostenwahrheit sichergestellt werden. Für Begrenzung des Flächenverbrauchs sind wirksame Instrumente zu etablieren. Die Naturwiederherstellungsverordnung der EU ist zumindest ein erster Ansatz dazu.
Weitere mögliche Mittel:
- Wohnungstauschmanagement: Beseitigung von Hemmungen für erwünschten Wohnungstausch; Stärkung der Marktkräfte zur Optimierung der Ressource Wohnfläche; Tauschen muss sich lohnen - und zwar sowohl für die Mieter Als auch für die Wohnungsunternehmen.
- Leerstandsmanagement: Die Haltung, dass Leerstand an sich keinen Handlungsbedarf erzeugt und als Fluktuationsreserve zur Normalität gehört, ist überholt. Die staatlichen Instrumente des Planungsrechts, wie sie bei Problemimmobilien zur Anwendung kommen können, sind zu aufwändig. Leerstand muss teuer sein. Der Bund müsste Rahmensetzungen so umgestalten, dass Leerstände wieder in den Markt kommen und zwar so günstig, dass sich eine Entwicklung der Objekte einschließlich der notwendigen energetische Modernisierung lohnt. Die Bevorratung darf sich finanziell nicht mehr lohnen. Das Leerstehenlassen in Erwartung steigender Immobilienpreise darf sich ebenfalls nicht lohnen. Die in Hamburg eingeführte Grundsteuer C greift hier zu kurz, das sie nun unbebaute Grundstücke erfasst.
Höhere Preise werden kurzfristig, aber vor allem mittel- u. langfristig zu erheblichen CO²-Einsparungen führen, zunächst durch Senkung des Energieverbrauchs, dann durch Reduzierung von Wohnfläche pro Einwohner und die Umstellung auf erneuerbare Heizenergie. Die höheren Steuereinnahmen und ersparte Subventionen sollten wo erforderlich zur personenbezogenen Subvention sowie insbesondere zur Transformation und nicht zur Subventionierung des Konsums genutzt werden.
Bei den höheren Energie- u. Wohnkosten sind die staatlichen Interventionen (Steuern, Förderungen, Vorgaben etc.) so umzubauen, dass das Ziel Nachhaltigkeit erreicht wird unter gleichbleibender finanzieller Gesamtbelastung der Bevölkerung. Damit einhergehen muss die soziale Abfederung der Belastung für diejenigen, die nicht über ausreichende finanzielle Möglichkeiten verfügen.