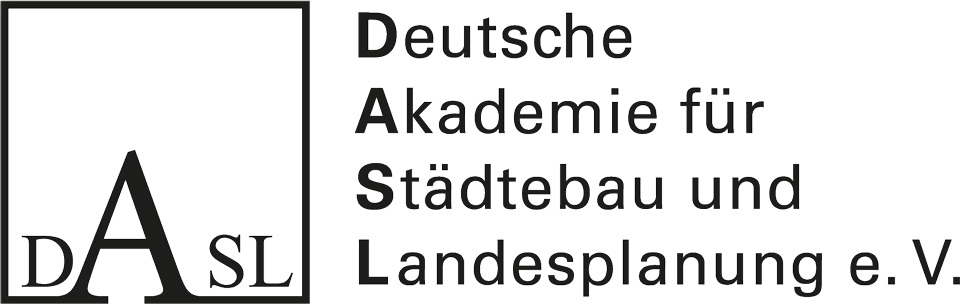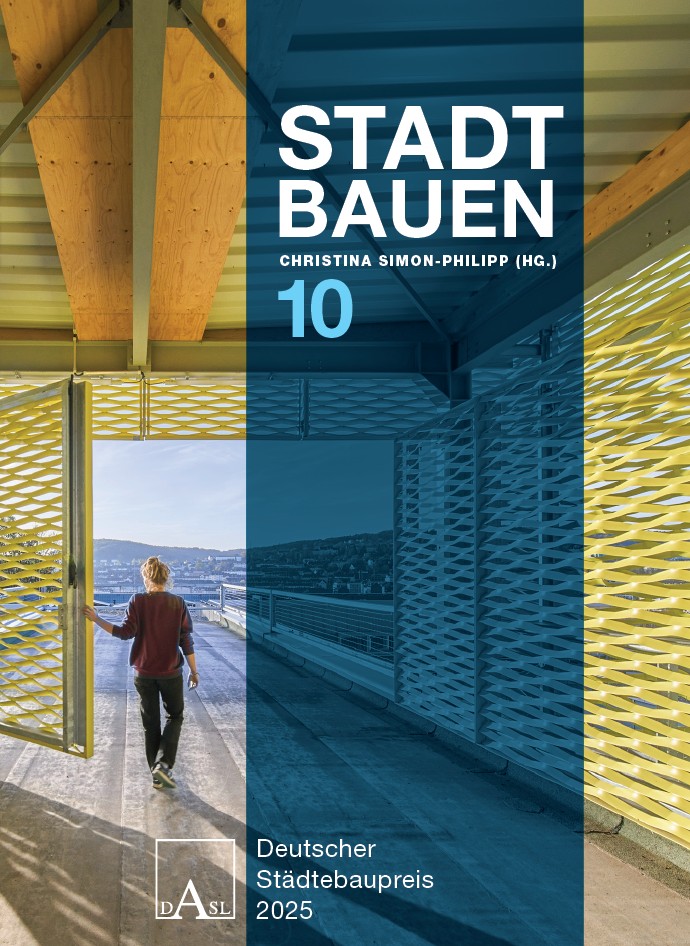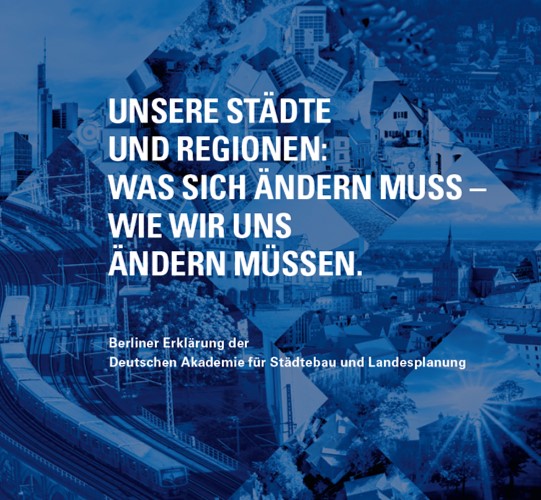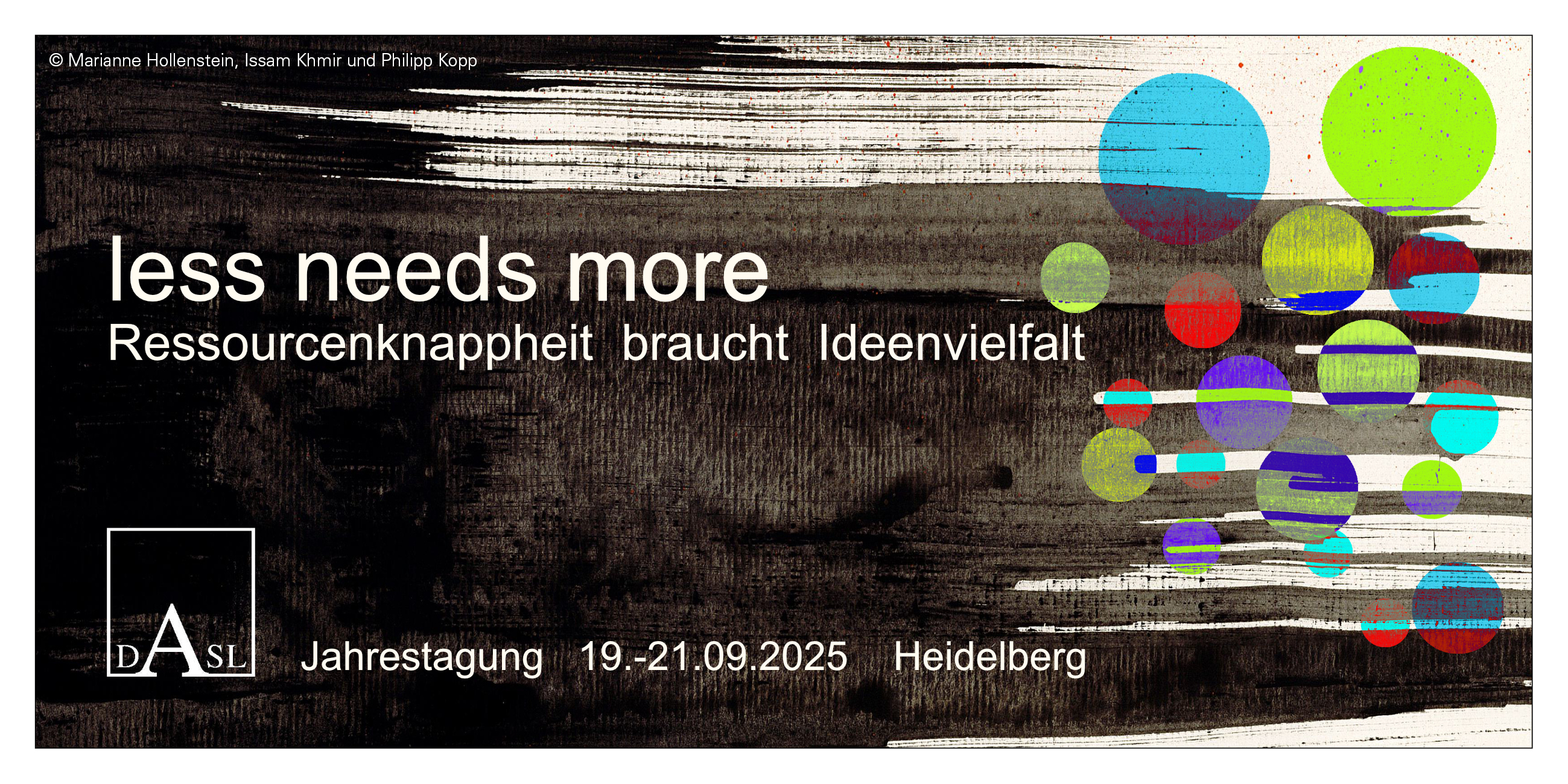Zur Vorbereitung dieser Jahrestagung mit dem Schwerpunkt „Less needs more – Ressourcenknappheit braucht Ideenvielfalt” wurde in der Landesgruppe Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen.
Für den von der Landesgruppe präferierten Schwerpunkt „Netto-Null-Flächenverbrauch“ konnte die Landesgruppe NRW als Partner gewonnen werden.
Beide Landesgruppen werden ihre jeweiligen Thesen in einer Fishbowl präsentieren und anschließend untereinander und mit dem Plenum diskutieren. In diesem Blog-Beitrag werden die Thesen der Landesgruppe Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland in Kurzform vorgestellt.
Nachfolgend werden die Thesen der Landesgruppe in Kurzform vorgestellt.
These 1: Innen frisst Außen
(Holger Heinze – Bianca Klein)
Für die Nachverdichtung der Städte im urbanen Raum gibt es etablierte Rahmenbedingungen und Steuerungsprozesse. Die in der Regel notwendigen, großflächigen technischen Serviceeinrichtungen für die Stadt (Stromtrassen, Gas- und Wasserleitungen, WEA, Umspannwerke, etc.) finden keinen Platz mehr in den Städten und nehmen daher den Außenraum in Anspruch – ohne dass alle Rahmenbedingungen gut erfasst und Steuerungsprozesse für alle Beteiligte transparent abgebildet werden. Die technischen Serviceinfrastrukturen müssen als Ganzes in den Blick genommen werden, um den Eingriff in den Außenraum zu minimieren. Stadt und Außenraum müssen daher zusammen gedacht werden.
These 2: Jede Fläche ist eine Konversionsfläche
(Monika Meyer – Markus Eichberger)
Jede Fläche muss als potenzielle Konversionsfläche verstanden werden – das heißt, sie kann bzw. muss mehrfach genutzt werden und/oder die Erstnutzung muss mit der Möglichkeit verbunden sein, im Zeitverlauf andere Nutzungen zu erfahren bis hin zu einem Rückbau. Das bedeutet, mehrfache Nutzungen vorzusehen, resiliente Gebäude- oder Flächengestaltung zu planen, temporäre Nutzungen zu ermöglichen sowie ggf. eine Rückgabe an die Natur mitzudenken. Dies erfordert eine andere Planungslogik, die auf resiliente Strukturen, flexible Nutzungen und temporäre Konzepte setzt.
These 3: Mischen Possible! – Nutzungsvielfalt statt Monostrukturen
(Christoph Haller – Gerd-Rainer Damm)
In einer Lebensumwelt mit großen Ansprüchen an Flexibilität und individualisierten Lebensformen werden singuläre Nutzungstypologien zunehmend ineffizient. Mit Monostrukturen kann nur unzureichend auf neue Herausforderungen und Rahmenbedingungen reagiert werden, weil sich ändernde Nutzungen schwer Raum finden. Dies provoziert neue Flächeninanspruchnahme. Gemischte Nutzungen, die eine gleichzeitige Nutzung von Gebäuden oder Stadtteilen für verschiedene Zwecke, z. B. Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Einzelhandel vorsehen, können flächensparend sein. Im Bestand sollten gemischte Nutzungen gesichert und bei Neuplanungen vorgesehen werden. Dafür sind nicht zwingend neue Planungsinstrumente erforderlich – es bedarf vielmehr v.a. einer besseren Koordination der einzelnen Planungsstränge und eine möglichst ressortübergreifende und interkommunale Kooperation.
These 4 Die Hose braucht `nen Gummizug
(Sonja Moers – Peter Sturm)
Das bisherige Leitbild, Außenbereiche durch eine Abgrenzung gegenüber Siedlungsflächen zu schützen, ist kontraproduktiv. Statt eines starren „Gürtels“ braucht es einen flexiblen „Gummizug“, mit dem im Rahmen einer integrierten Betrachtung von „Innen und Außen“ Monostrukturen vermieden und die Flächeninanspruchnahme in der Gesamtbilanz optimiert werden. Voraussetzungen hierfür sind verbindliche Ziele, Regeln sowie eine aktive kommunale Bodenpolitik, die kurzfristigen politischen Interessenslagen entzogen ist. Die damit verbundenen Chancen sollten aktiv kommuniziert werden, nicht nur unter Fachleuten, sondern auch zu Entscheidungsträgern und in die Öffentlichkeit. Besonders die Schaffung von Win-Win-Situationen ermöglicht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen Ebenen.
geschrieben von:
Gerd-Rainer Damm, Christoph Haller, Holger Heinze, Bianca Klein, Monika Meyer, Sonja Moers, Peter Sturm, Markus Eichberger