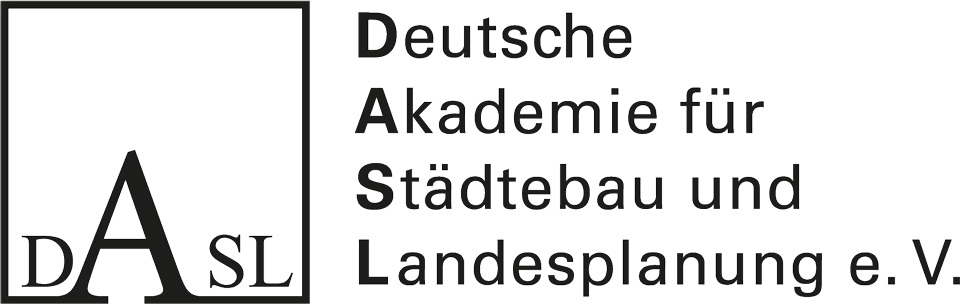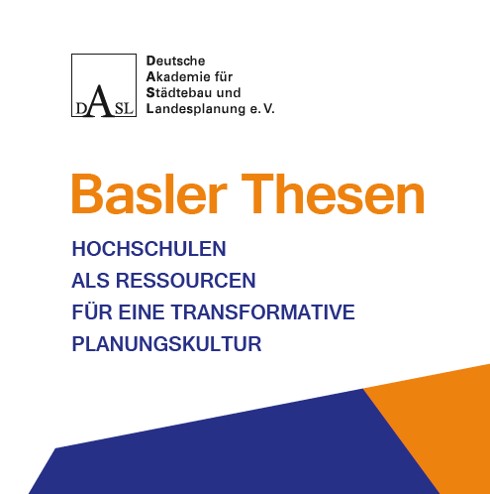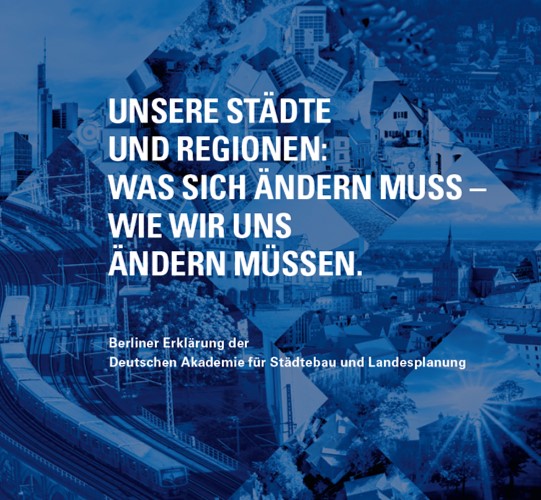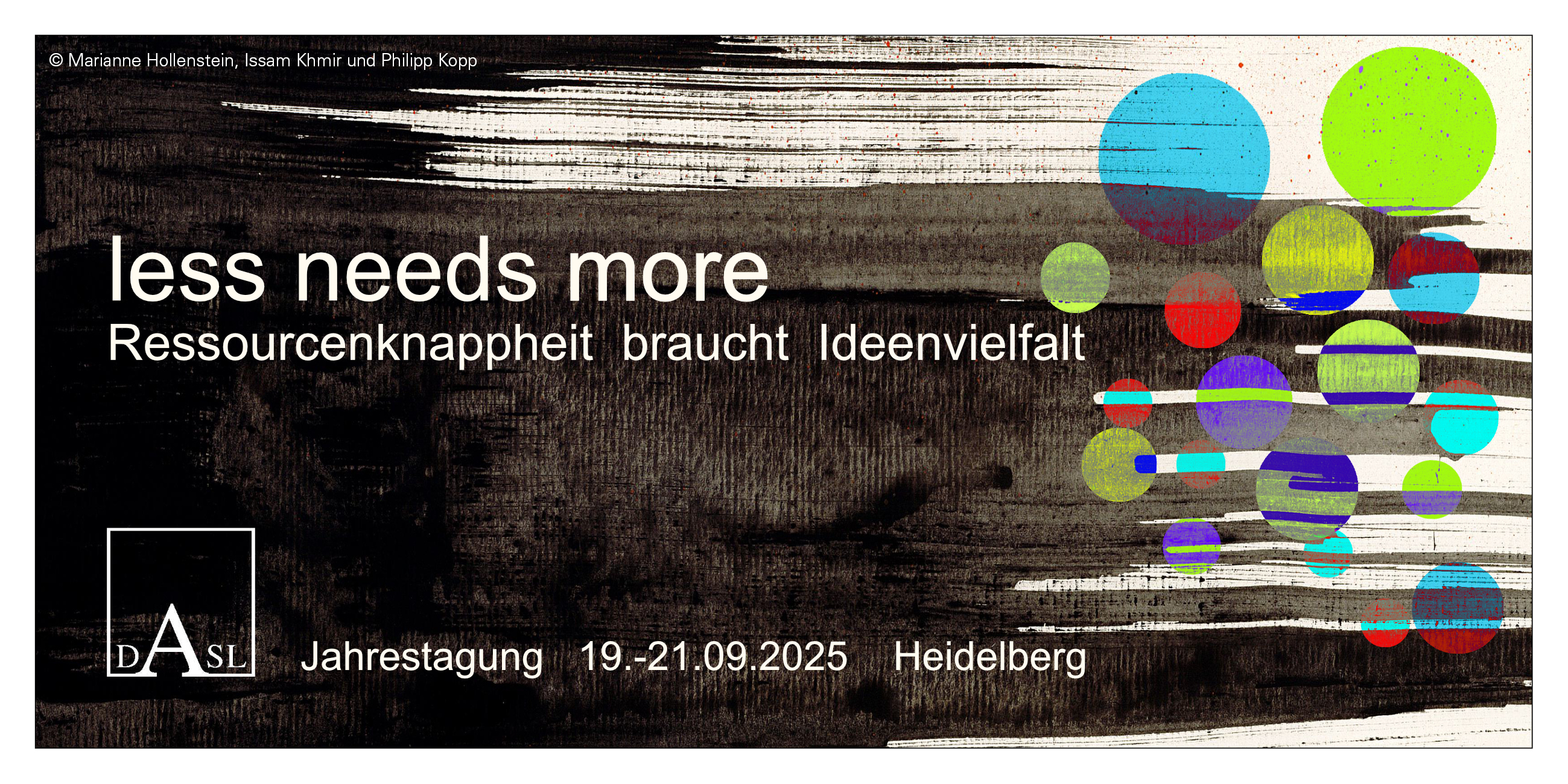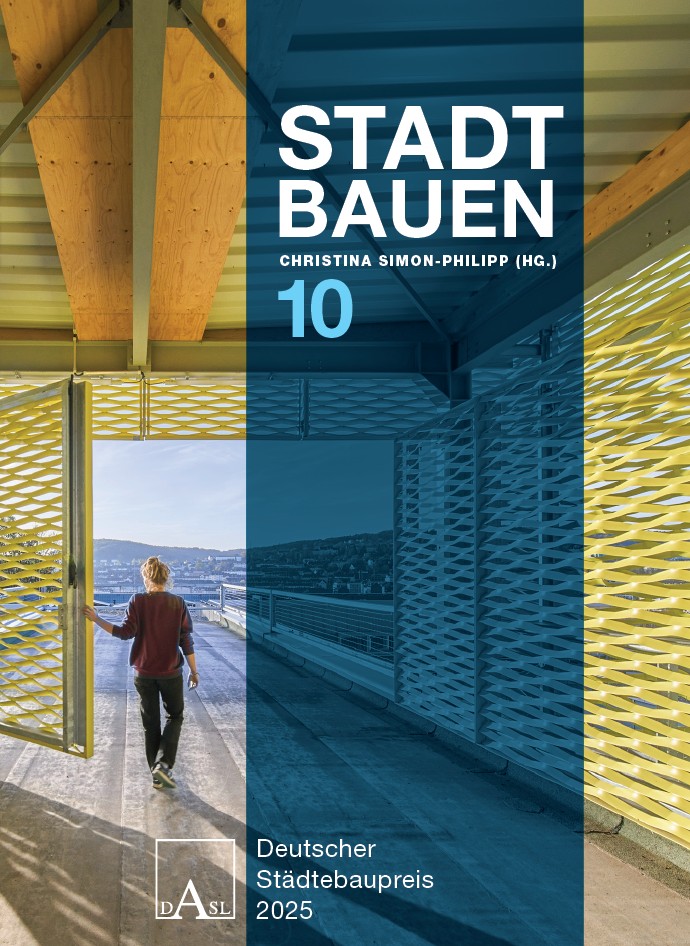Der Flächenverbrauch in Deutschland ist nach wie vor zu hoch – trotz ehrgeiziger nationaler und europäischer Ziele. Wenn wir die Perspektive einer Flächenkreislaufwirtschaft (Netto-Null-Flächeninanspruchnahme) bis 2050 ernst nehmen, reicht es nicht mehr, Flächen nur einer einzelnen Nutzung zuzuführen. Jede Fläche muss künftig mehr können. Dazu gehört etwa die Gewinnung von Energie bei gleichzeitiger Ermöglichung landwirtschaftlicher Produktion sowie die Vereinbarkeit von Hochwasserschutz und Naherholung. Multifunktionale Flächennutzung ist vor diesem Hintergrund ein Schlüssel, um die knappe Ressource Boden effizienter und gerechter zu nutzen. Das Raumordnungsrecht hat diesen Ansatz inzwischen ausdrücklich aufgegriffen – ein wichtiger Impuls, um aus der Theorie in die Praxis zu kommen. Dieser Beitrag bezieht sich in Teilen auf einen Aufsatz, den der Autor gemeinsam mit Prof. Dr. Sabine Schlacke (Universität Greifswald) in der Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR) 2024, S. 323 ff. unter dem Titel „Multifunktionale Flächennutzung: Potentiale und Grenzen des Raumordnungsrechts“ veröffentlicht hat.
Autor: Christoph Plate
Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster (ZIR, Forschungsinstitut in der DASL)
Institut für Energie-, Umwelt- und Seerecht (IfEUS), Universität Greifswald
15. September 2025
I. Flächenverbrauchsziele – zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Deutschland verbraucht nach wie vor zu viel Fläche. Die Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke schreitet in einem Maße voran, das weit über den (überwiegend politisch) festgelegten Flächenverbrauchszielen liegt, die als Nachhaltigkeitsagenden für die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union festgeschrieben wurden. Für das vierjährige Mittel der Jahre 2020-2023 wurde für das Bundesgebiet ein durchschnittlicher Flächenverbrauch von 51 Hektar pro Tag ermittelt.1 Dies entspricht mehr als 70 Fußballfeldern. Dieser anhaltend hohe Flächenverbrauch ist besorgniserregend. Der Schutz der Freiflächen, insbesondere des planerischen unbebauten Außenbereichs, ist essentiell für den Erhalt der mannigfaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen der Ressourcen (und umweltrechtlichen Schutzgüter) Boden und Fläche.
Es besteht daher ein breiter Konsens in Wissenschaft und Praxis, dass der Umfang der derzeitigen Flächeninanspruchnahme „kein zukunftsfähiges Boden-Ressourcen-Management“ 2 darstellt. Es mangelt auch auf rechtspolitischer Ebene nicht an Zielfestlegungen und Absichtserklärungen, wie das nationale „30 Hektar - x“-Ziel bis 2030 und die auf nationaler und europäischer Ebene bis zum Jahr 2050 anvisierte Flächenkreislaufwirtschaft (Netto-Null-Flächeninanspruchnahme) zeigen. Angesichts des bisherigen Trends der täglichen Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke (maßgeblicher Indikator), der flächenpolitischen Entwicklungen und der nur begrenzten Wirkung der rechtlichen Initiativen und Maßnahmen (Vorrang der Innenentwicklung, Bodenschutzklausel etc.) scheint eine Verwirklichung dieser Ziele zum jetzigen Stand aber nur schwer vorstellbar.
Aktuelle Forschungen bestätigen diese Einschätzung. Danach wird eine Reihe gewichtiger Faktoren einen fortschreitenden Anstieg der Flächenneuinanspruchnahme eher noch begünstigen. Diese reichen u. a. von einem verstärkten Wohnungs- und Industrieneubau über einen erwarteten hohen Verkehrsflächenausbau sowie einer Ausdehnung des ökologischen Landbaus bis hin zum dringend benötigten und schon jetzt gesetzlich vorangetriebenen Ausbau der erneuerbaren Energien mit all seinen Facetten (inklusive der dafür benötigten Infrastruktur).3 Diese Ansprüche an die begrenzte Ressource Fläche stehen zum Teil in einer nur schwer auflösbaren Konkurrenz zueinander.
II. Anstieg von Flächennutzungen und Flächennutzungskonkurrenzen
Die Zunahme der Flächennutzungskonkurrenzen wird nicht zuletzt von einer Reihe rechtlicher Entwicklungen der letzten Jahre befördert. In diesem Kanon an Zielsetzungen nehmen flächenbezogene Zielfestlegungen eine besondere Stellung ein. Zu nennen sind hier aus der Klimaschutzperspektive die Senkenziele für den sog. LULUCF-Sektor (Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft, vgl. § 3a KSG), die eine Wiederherstellung der Senkenfunktion durch Flächenumnutzungen und Flächenschutz voraussetzen.4 Auch für den Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien hat der Gesetzgeber Regelungen erlassen, die einen konkreten Flächenbezug haben (vgl. § 4 EEG). So werden durch das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) gegenüber den Ländern verbindliche Flächenbeitragswerte5 zur Ausweisung von Windenergiegebieten vorgegeben und die Neufassung des § 2 S. 2 EEG gibt vor, dass der Belang des Ausbaus der erneuerbaren Energien solange als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden soll, bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist. Neben dieser Priorisierung hat der Gesetzgeber den Katalog privilegierter Vorhaben im Außenbereich zugunsten des Ausbaus von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien erweitert (vgl. § 35 Abs. 1 BauGB). Als jüngstes Beispiel für gesetzliche Vorgaben mit Flächenbezug kann die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (Verordnung [EU] 2024/1991) genannt werden, die ihrerseits in den Mitgliedstaaten umzusetzende flächenbezogene Wiederherstellungsmaßnahmen vorschreibt.
All diese für sich genommen politisch bedeutsamen Zielsetzungen mit Flächenbezug dürfen allerdings nicht dazu führen, dass die Relevanz des eingangs skizzierten gegenwärtig viel zu hohen Flächenverbrauchs an den Rand des politischen und regelungstechnischen Interessenschwerpunkts gedrängt wird.
III. Multifunktionalität im Raumordnungsrecht
Der Schutz der Freiflächen und die dafür anvisierte Flächenkreislaufwirtschaft mit einer Netto-Null-Flächeninanspruchnahme setzen neben anderen wichtigen Maßnahmen (Flächenrückbau durch Entsiegelung etc.) voraus, dass die bereits (baulich) in Anspruch genommenen Flächen intensiver und im besten Fall multi- bzw. mehrdimensional genutzt werden.6 Unter Multifunktionalität wird im Folgenden die gleichzeitige Verwirklichung von zwei oder mehreren verschiedenen Nutzungen auf derselben Fläche verstanden. Nicht gemeint ist dagegen eine Nutzung, die mehrere Funktionen erfüllt.7 Praktische Beispiele für eine solche synergetische Flächennutzung lassen sich inzwischen in großer Fülle auffinden. Beispielhaft zu nennen sind etwa Photovoltaikfreiflächenanlagen auf zugleich landwirtschaftlich genutzten Flächen (Agri-PV), eine Kombination aus Hochwasserschutz und Naherholung (Retentionsräume als Freizeiträume) und die kombinierte Wind- und Solarenergiegewinnung an einem Standort.8
Eine besondere Rolle für die Umsetzung und Förderung multifunktionaler Flächennutzungen im Freiraum spielt – neben den bereits seit längerem praktizierten Ansätzen im Städtebau und damit im planerischen Innenraum9 – die Raumordnung als überörtliche und überfachliche Planung mit Raumbezug (Raumplanung). Die Raumordnung hat die Aufgabe, die räumlichen Funktionen und Nutzungen zu ordnen und zu koordinieren (vgl. §§ 1, 7 Raumordnungsgesetz, ROG). Dabei werden die Entscheidungen über potenziell zulässige, raumbedeutsame Nutzungen unter Einbeziehung von lokalen und regionalen Stakeholdern getroffen, was sich auf die Qualität der Festlegungen und deren Akzeptanz bei den Regelungsadressaten auswirkt. Als wichtigstes Instrument der Raumordnung dienen Raumordnungspläne, in denen verbindliche Festlegungen als Ziele (hohe Bindungswirkung) und Grundsätze der Raumordnung zur Raumstruktur, insbesondere zu Nutzungen und Funktionen des Raums, getroffen werden. Dabei kann auch festgelegt werden, dass bestimmte Nutzungen und Funktionen des Raums nur für einen bestimmten Zeitraum vorgesehen sind, was eine flexible Raumplanung ermöglicht.
Die Festlegungen in Raumordnungsplänen können auch ganze Gebiete bezeichnen und damit einer Nutzung einen Vorrang einräumen (Vorranggebiete) oder sie mit einem besonderen Gewicht versehen (Vorbehaltsgebiete). Als gutes Beispiel für die Begünstigung der Mehrfachnutzung einer Fläche durch raumordnerische Festlegungen dient die Ausweisung von Vorranggebieten (vgl. § 7 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ROG). Zwar kann der Träger der Raumordnung mittels Vorranggebietsausweisungen in erster Linie ein Gebiet für eine bestimmte Aufgabe reservieren.10 Innerhalb eines Vorranggebietes sind aber auch immer verschiedene (Mehrfach-)Flächennutzungen möglich. Dies ist immer dann raumordnungsrechtlich gestattet, wenn die vom Träger der Raumordnungsplanung für das Gebiet vorgesehene (vorrangige) Nutzung durch die hinzukommende Nutzung nicht beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund ist etwa eine Agri-PV-Nutzungsüberschneidung möglich, weil sich beide Nutzungen (Landwirtschaft und Photovoltaik) in bestimmten Kombinationen nicht gegenseitig beeinträchtigen.11 Hinzu kommt, dass das Raumordnungsrecht – anders als das Bauplanungsrecht (vgl. § 9 BauGB) – keinen abschließenden Katalog zulässiger Festlegungsinhalte kennt,12 was den Trägern der Raumordnungsplanung inhaltliche Freiheiten zur Ermöglichung von Mehrfachnutzungen gibt.
Trotz dieser materiell-rechtlichen Zulässigkeit einer raumordnerischen Steuerung zur Förderung multifunktionaler Flächennutzungen waren die Begriffe „Multifunktionalität“ oder „Mehrfachnutzung“ dem ROG und den Landesplanungsgesetzen bislang weitgehend fremd. Dies hat der Gesetzgeber des Raumordnungsgesetzes im Zuge des Gesetzes zur Umsetzung der sog. RED III Richtlinie (Richtlinie [EU] 2023/2413) insofern geändert, als dass er den Wortlaut des § 7 Abs. 1 S. 2 ROG ergänzt hat. Nunmehr kann ausdrücklich festgelegt werden, „dass bestimmte Flächen des Planungsraums einschließlich Gebietsausweisungen nach Absatz 3 für mehrere miteinander vereinbare Nutzungen und Funktionen vorgesehen werden (Mehrfachnutzung)“.13 Damit schafft der Gesetzgeber zwar keine neue materiell-rechtliche Ermächtigung für die Ermöglichung multifunktionaler Flächennutzungen (die schon zuvor möglich waren, sondern unterstreicht vielmehr die bereits bestehende Rechtslage. Der Ergänzung des § 7 Abs. 1 S. 2 ROG kommt aber zumindest eine Anstoß- und Anreizfunktion zu. In dieser Eigenschaft ist die Klarstellung durchaus begrüßenswert, auch wenn eine noch prominentere Stelle zu Beginn des ROG, etwa als Leitvorstellung der Raumordnung (§ 1 Abs. 2 ROG), diesen Effekt wohl verstärkt hätte. Jedenfalls bleibt zu hoffen, dass eine Kombination verschiedener Nutzungen auf einer Fläche kein exotisches Fallbeispiel bleibt, sondern der planungsrechtliche Normallfall wird.
IV. Fazit
Um die Erreichung der (politischen) Flächenverbrauchsziele auf europäischer und nationaler Ebene zu erreichen und den in Zukunft weiter steigenden Flächennutzungskonkurrenzen zu begegnen, muss die derzeit genutzte Fläche intensiver und effizienter genutzt werden. Für die Freiflächen im Außenbereich kann dies durch eine starke Raumordnungsplanung bewältigt werden, welche die Funktionen und Nutzungen des Raums zuordnet und koordiniert. Multifunktionale Flächennutzungen waren insofern schon vor der Einführung des § 7 Abs. 1 S. 2 ROG möglich. Dennoch kann diese gesetzgeberische Klarstellung die Dringlichkeit von multifunktionalen Flächennutzungen unterstreichen und insofern eine Anstoß- und Anreizfunktion übernehmen.
1 Destatis, Pressemitteilung v. 5.8.2025, abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html.
2 Kment, Verfassungsfragen zum Gesetzesentwurf der Bayerischen Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (LT-Drucksache 17/16760), Rechtswissenschaftliches Gutachten, S. 54.
3 Dazu umfassend Osterburg/Ackermann/Böhm et al., Flächennutzung und Flächennutzungsansprüche in Deutschland, S. 19 ff., abrufbar unter https://www.thuenen.de/de/newsroom/detail/landwirtschaftliche-boeden-sorgsam-mit-der-wertvollen-ressource-umgehen.
4 Dies gilt etwa für die Wiedervernässung von Moorflächen, die für landwirtschaftliche Zwecke trockengelegt wurden.
5 Dazu Schlacke/Plate/Thierjung, Beschleunigung des WEA-Ausbaus: Befund, Umsetzung, role model – eine Zwischenbilanz, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2025, S. 441 ff.
6 Dazu nur Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), Hauptgutachten „Landwende im Anthropozän“, 2020, S. 2 abrufbar unter https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/landwende; Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Renaturierung: Biodiversität stärken, Flächen zukunftsfähig bewirtschaften, Stellungnahme 2024, Rz. 11, abrufbar unter https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2024_04_Renaturierung.html; s. dazu auch umfassend Schlacke (Hrsg.), Multifunktionalität von Flächen, Tagungsband des Symposiums des Zentralinstituts für Raumplanung an der Universität Münster 2023.
7 Vgl. Schlacke/Plate, Multifunktionale Flächennutzung: Potentiale und Grenzen des Raumordnungsrechts, Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR) 2024, S. 327.
8 Dazu umfassend Schlacke, Rechtsgutachten „Zur Doppelnutzung von Flächen: Freiflächen-Solarenergieanlagen in Windenergiegebieten“ 2024 im Auftrag des MWIKE NRW, abrufbar unter https://www.energy4climate.nrw/aktuelles/newsroom/untersuchung-zur-doppelnutzung-von-flaechen-fuer-wind-und-solarvorhaben.
9 Dazu Lorenzen, Steuerung multifunktionaler Flächen im urbanen Raum, Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR) 2024, S. 332 ff.
10 Grotefels, in: Kment, ROG, Kommentar (1. Auflage 2019), § 7 Rn. 50.
11 Dazu Schlacke/Plate, Multifunktionale Flächennutzung: Potentiale und Grenzen des Raumordnungsrechts, Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR) 2024, S. 328 f.
12 Dazu nur Kümper, in: Kment, ROG (1. Auflage 2019), § 3 Rn. 71.
13 BR-Drs. 329/25, S. 16; s. zur Erwähnung der Mehrfachnutzung im energierechtlichen Kontext im EU-Recht (RED III) Art. 15b Abs. 3 RED III.