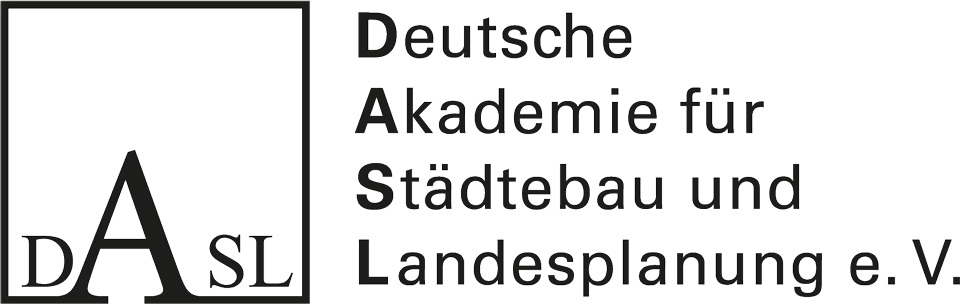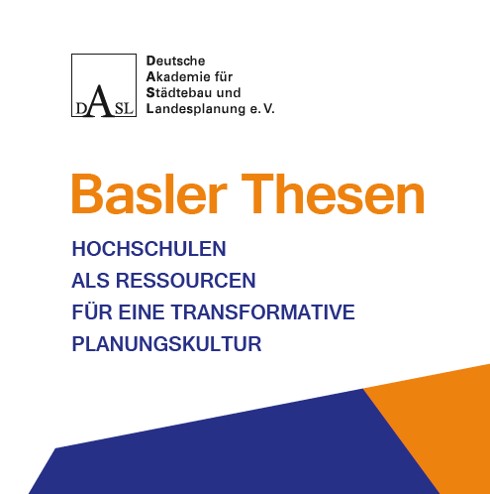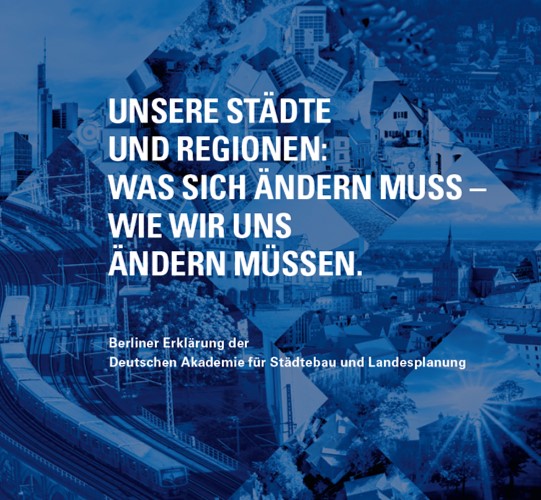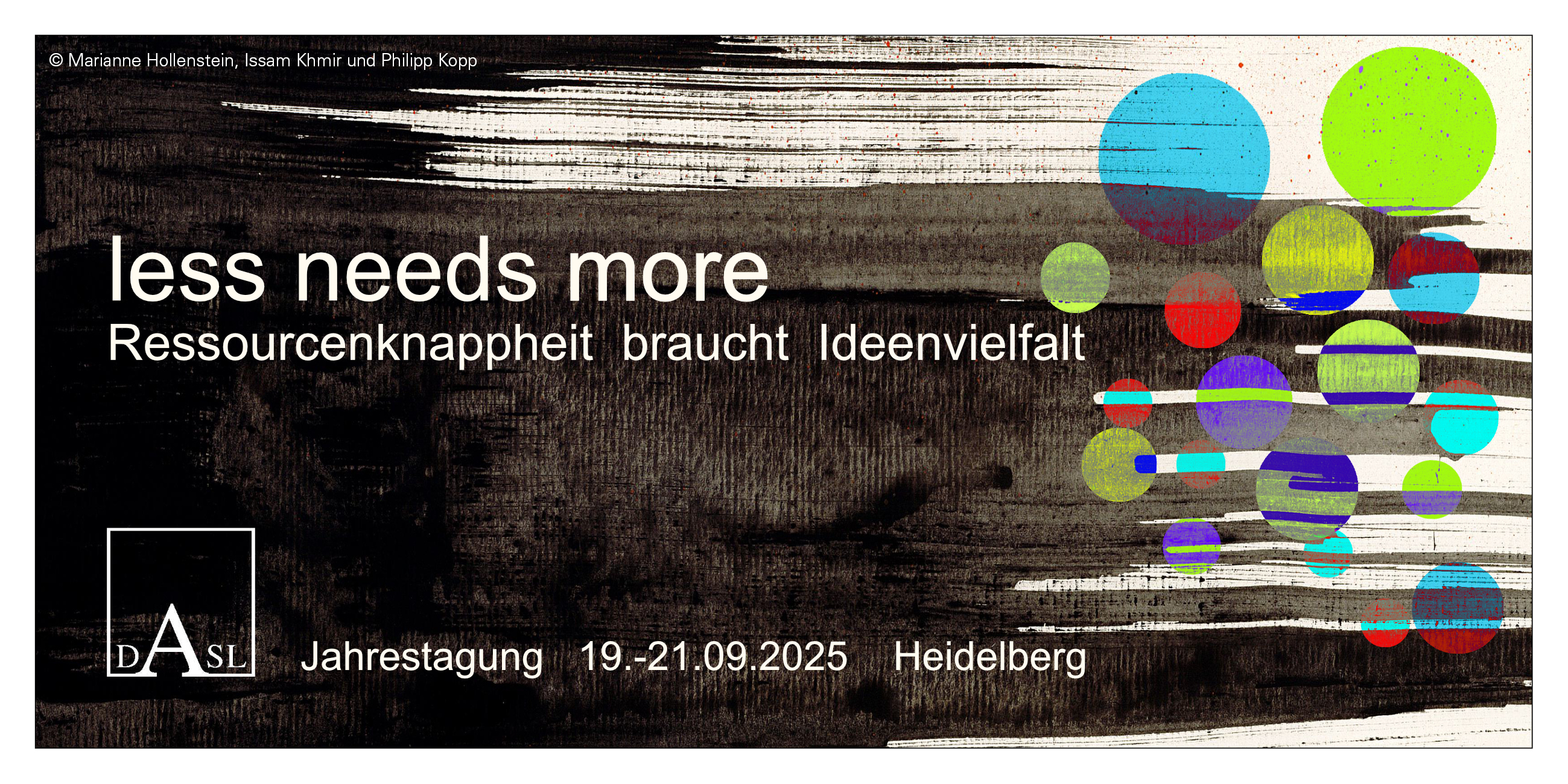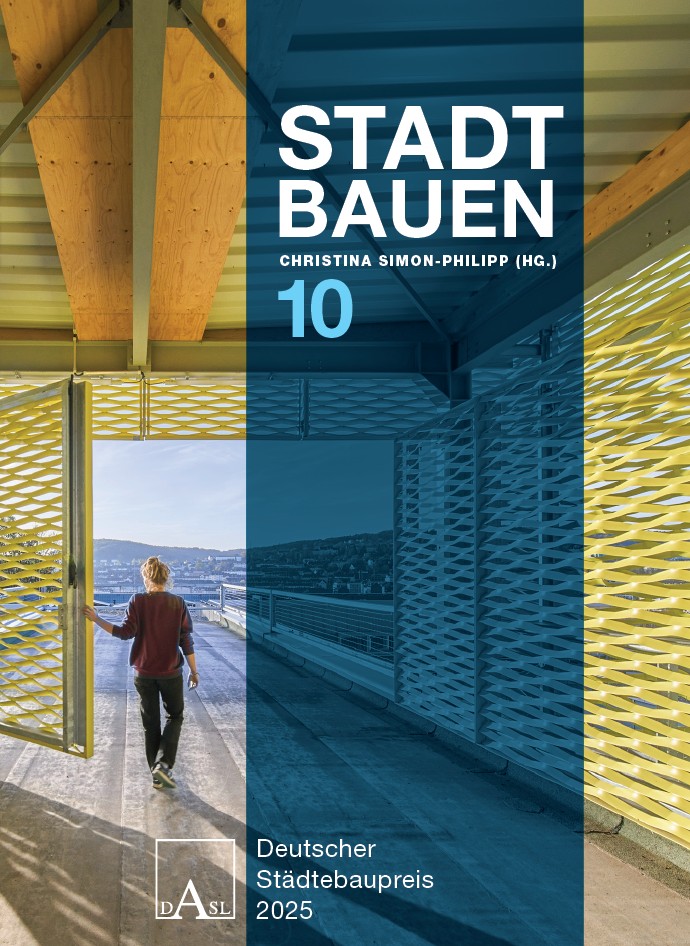Die Revitalisierung von Industrie-Standorten genießt auf politischer und planerischer Ebene einen hohen Stellenwert. Um die Perspektive der Endnutzer einzubringen, möchte ich einige grundlegende Überlegungen teilen, die dazu beitragen können, Revitalisierungsprojekte erfolgreich und nachhaltig umzusetzen.
Perspektive: Industrie-Eigentümer, der den Standort verlässt
Zusammenfassung:
Der Standort ist für die geplante Nutzung geeignet, und die geplante Nutzung passt zum Standort. Ab einer bestimmten Größe kann ein Standort auch gezielt entwickelt werden. Die rechtlichen und physischen Rahmenbedingungen sollten eine zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung ermöglichen.
Ziele:
1. Werthaltige Wiederverwendung der Flächen sicherstellen
2. Schneller Exit
3. Sicherer Exit
Perspektive: Industrieunternehmen als Suchender
Der Standort muss nutzungsgerecht und im gewünschten Zeit- und Kostenrahmen verfügbar sein.
Ziele:
4. Geeignete Lage und Immobilie für die geplante Nutzung finden
5. Realisierung im passenden Zeitrahmen
6. Lösung im Budget
Erfolgsfaktoren für eine werthaltige Umsetzung im akzeptablen Zeithorizont
1. Marktbedürfnisse analysieren:
Was wird aktuell und in den nächsten zehn Jahren nachgefragt? Welche Trends und Veränderungen gibt es im Umfeld?
2. Physische Flexibilität des Standorts:
Ist der Standort anpassungsfähig für verschiedene Nutzungen? (Größe, Bodenbeschaffenheit, Altlasten, Infrastruktur wie Strom, Telekommunikation, ÖPNV, Straßen, Bahn, Wasser, Abwasser etc.)
3. Bauliche Anlagen:
Sind die Gebäude in Größe und Dichte geeignet oder entwickelbar, um eine wirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen? Ist die Substanz in einem Zustand, der eine Entwicklung sinnvoll erscheinen lässt?
4. Rechtliche Rahmenbedingungen:
Sind alle rechtlichen Voraussetzungen geklärt und ermöglichen sie eine Entwicklung im vorgesehenen Kostenrahmen? (Dichte, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Regionalplan, Auflagen, Infrastruktur, Zeitplan etc.)
5. Kompetenz der Baurechtshoheit:
Verfügt die zuständige Körperschaft über die nötige Kompetenz und Systematik zur Realisierung? (Personal, strukturelle Engpässe, politische Unterstützung etc.)
6. Due Diligence:
Liegt eine vollständige rechtliche und physische Prüfung vor? Gibt es relevante Erkenntnisse, die für oder gegen das Projekt sprechen?
7. Nachfrager und Endnutzer:
Gibt es aktuelle Interessenten für die geplante Nutzung, z.B. Projektentwickler mit passendem Portfolio? Gibt es potenzielle Endnutzer mit einem passenden Zeithorizont?
Grundlegende Hinweise für suchende Nutzer
- Aktueller Nutzungsbedarf wartet selten drei Jahre auf Bezug. Alles darüber hinaus ist spekulativ und meist das Geschäft von Projektentwicklern oder dient der langfristigen Standortsicherung (selten).
- Menschen sind entscheidend: Gibt es qualifizierte Mitarbeiter vor Ort oder ist der Standort attraktiv genug, um Mitarbeiter zu gewinnen?
- Mietkostenspektrum: Jede Nutzung hat ein typisches Mietniveau, das sich an Nutzung und Standortqualität orientiert.
- Flächengrößen: Industriegebäude unter 10.000 m² Nutzfläche sind meist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
- Gebäudetypen: Logistik benötigt z.B. mindestens 8, besser 10+ Meter lichte Höhe und mindestens 5.000 m² Nutzfläche.
- Standortanforderungen: Jede Nutzung hat spezifische Anforderungen, die nicht ignoriert werden dürfen.
- Besonderheiten des Standorts: Wertsteigernde Faktoren wie Wasserlage, Hanglage, Expansionsmöglichkeiten sollten berücksichtigt werden.
- Nutzungsmix: Vorsicht bei schwierigen Kombinationen wie hochwertige Büro- oder Wohnnutzung im Logistikumfeld, Industrie im Wohnumfeld, Shoppingcenter vs. Innenstadt etc.
Fazit:
Eine erfolgreiche Revitalisierung erfordert die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Beteiligten, eine flexible und zukunftsorientierte Planung sowie eine klare rechtliche und wirtschaftliche Grundlage. Nur so kann ein Standort nachhaltig und werthaltig wiederbelebt werden.
Revitalisierung von Industrie-Standorten: Erfolgsfaktoren aus Endnutzer-Sicht
Die Revitalisierung von Industrie-Standorten ist für Politik und Planung ein zentrales Thema. Doch der dauerhafte Erfolg hängt maßgeblich davon ab, wie gut die Bedürfnisse der späteren Nutzer berücksichtigt werden. Im Folgenden zeige ich anhand konkreter Beispiele, worauf es in der Praxis ankommt.
Perspektive: Industrie-Eigentümer, der den Standort verlässt
Beispiel:
Ein Automobilzulieferer gibt ein 50.000 m² großes Werk in Süddeutschland auf. Für den Eigentümer ist entscheidend, dass die Fläche schnell und werthaltig weitergenutzt wird – etwa durch Verkauf an einen Logistikdienstleister oder durch Umnutzung für die Produktion von Batteriezellen.
Ziele:
1. Werthaltige Wiederverwendung der Flächen (z.B. Verkauf an einen solventen Käufer, der die Fläche weiterentwickelt)
2. Schneller Exit (z.B. Abschluss des Verkaufs innerhalb von 12 Monaten)
3. Sicherer Exit (z.B. keine Altlastenrisiken, klare rechtliche Rahmenbedingungen)
Perspektive: Industrieunternehmen als Suchender
Beispiel:
Ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen sucht kurzfristig eine neue Produktionsstätte, weil der aktuelle Mietvertrag ausläuft. Es benötigt eine Halle mit mindestens 10.000 m², Kranbahnen und guter Verkehrsanbindung – und das möglichst innerhalb von sechs Monaten.
Ziele:
4. Geeignete Lage und Immobilie für die avisierte Nutzung (z.B. Nähe zu Mitarbeitern, Autobahn und Zulieferern)
5. Realisierung im passenden Zeitrahmen (z.B. Einzug innerhalb eines halben Jahres)
6. Lösung im Budget (z.B. maximal 6 €/m² Miete)
Erfolgsfaktoren für eine werthaltige Umsetzung – mit Praxisbezug
- Marktbedürfnisse analysieren:
Beispiel: In einer Region mit wachsendem E-Commerce-Bedarf werden Logistikflächen stark nachgefragt. Ein ehemaliges Druckereigelände wird daher zu einem modernen Logistikpark umgebaut. (recycling)
2. Physische Flexibilität des Standorts:
Beispiel: Ein alter Industriestandort mit belastetem Boden wird durch gezielte Sanierung und Ausbau der Stromversorgung für die Ansiedlung eines Rechenzentrums attraktiv gemacht. (upcycling)
3. Bauliche Anlagen:
Beispiel: Eine leerstehende Lagerhalle wird durch Einziehen einer Zwischendecke und Einbau moderner Haustechnik für die Produktion von Medizintechnik umgebaut. (upcycling)
4. Rechtliche Rahmenbedingungen:
Beispiel: Ein Bebauungsplan wird angepasst, um die Ansiedlung von Start-ups im Bereich erneuerbare Energien zu ermöglichen. Ohne diese Anpassung wäre eine Nutzung als Innovationscampus nicht möglich.
5. Kompetenz der Baurechtshoheit:
Beispiel: Eine Kommune richtet eine Taskforce ein, um Genehmigungsprozesse für Großprojekte zu beschleunigen. Dadurch kann ein Investor innerhalb von neun Monaten Baurecht erhalten.
6. Due Diligence:
Beispiel: Bei der Prüfung eines alten Chemiewerks werden Altlasten entdeckt. Die Sanierungskosten werden in den Kaufpreis eingepreist, sodass das Projekt trotzdem wirtschaftlich bleibt.
7. Nachfrager und Endnutzer:
Beispiel: Ein Projektentwickler sichert sich bereits vor dem Umbau einen langfristigen Mietvertrag mit einem Lebensmittelhersteller, der die Fläche ab 2026 nutzen will.
Grundlegende Hinweise für suchende Nutzer – mit Beispielen
- Aktueller Nutzungsbedarf wartet selten drei Jahre:
Beispiel: Ein Logistikunternehmen benötigt kurzfristig Flächen für ein neues Verteilzentrum. Ein Standort, der erst in drei Jahren verfügbar ist, scheidet aus. - Menschen sind entscheidend:
Beispiel: Ein Hightech-Unternehmen entscheidet sich für einen Standort in Stadtnähe, weil dort leichter qualifizierte Fachkräfte gewonnen werden können. - Mietkostenspektrum:
Beispiel: Für einfache Lagerflächen sind 4–8 €/m² üblich, für Hightech-Produktionsflächen können es 8–12 €/m² sein. - Flächengrößen:
Beispiel: Ein Automobilzulieferer benötigt mindestens 15.000 m² zusammenhängende Hallenfläche, kleinere Einheiten sind für ihn nicht wirtschaftlich. - Gebäudetypen:
Beispiel: Ein Logistiker benötigt Hallen mit mindestens 10 Metern lichter Höhe und ausreichend Rangierfläche für Lkw. - Fristigkeiten:
Die Gebäude sollten mehrere Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigen. Ein Gebäude soll 50 oder 100 Jahre leben. Eine typische Industrie oder Gewerbe Nutzung wird alle 8-12 Jahre grundlegend verändert / modernisiert. Um dies zu ermöglichen, braucht es Ausweichflächen auf dem Areal. Eine Reserve Baufläche macht die Immobiliennutzung nachhaltiger. - Standortanforderungen:
Beispiel: Ein Chemieunternehmen benötigt zwingend einen Gleisanschluss für Rohstofflieferungen. - Besonderheiten des Standorts:
Beispiel: Ein Standort am Wasser wird für einen Hersteller von Freizeitbooten besonders attraktiv. - Nutzungsmix:
Beispiel: Die Ansiedlung eines großen Logistikzentrums in direkter Nachbarschaft zu hochwertigem Wohnraum führt häufig zu Konflikten und sollte gut abgewogen werden.
Fazit:
Die erfolgreiche Revitalisierung von Industrie-Standorten gelingt, wenn die Bedürfnisse der Nutzer frühzeitig erkannt und in die Planung integriert werden. Praxisbeispiele zeigen: Flexibilität, Marktkenntnis und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten sind der Schlüssel zum Erfolg.
Revitalisierung von Industrie-Standorten: Was Stadtplaner wissen sollten
Die Umnutzung ehemaliger Industrieflächen ist für viele Städte eine große Chance – aber auch eine Herausforderung. Damit solche Projekte gelingen, ist es wichtig, die Perspektive der späteren Nutzer und die Anforderungen des Marktes zu verstehen. Hier einige zentrale Punkte und Beispiele aus der Praxis:
Was erwarten Eigentümer, die ihren Standort aufgeben?
Praxisbeispiel:
Ein Automobilzulieferer schließt sein Werk. Für die Stadt bedeutet das: Arbeitsplätze gehen verloren, aber es entsteht auch eine große, gut erschlossene Fläche. Der Eigentümer möchte die Fläche möglichst schnell und zu einem guten Preis verkaufen – idealerweise an einen Nutzer, der wenig Anpassungen benötigt.
Wichtige Punkte für Stadtplaner:
- Schnelle Nachnutzung verhindert Leerstand und Verfall.
- Klare und flexible rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. Bebauungsplan) beschleunigen den Prozess.
- Altlasten und Infrastruktur Kapazitäten sollten frühzeitig geklärt werden, um böse Überraschungen zu vermeiden.
2. Was suchen neue Nutzer?
Praxisbeispiel:
Ein mittelständisches Unternehmen sucht dringend eine neue Produktionshalle. Es braucht einen geeigneten Standort für seine Mitarbeiter, ausreichend große Flächen, eine gute Verkehrsanbindung und möchte möglichst schnell einziehen.
Wichtige Punkte für Stadtplaner:
- Die Nachfrage richtet sich oft nach aktuellen Trends (z.B. Logistik, E-Mobilität, Rechenzentren).
- Flächen müssen flexibel nutzbar sein (z.B. Hallenhöhen, Traglasten, Infrastruktur).
- Schnelle Genehmigungsverfahren sind ein Standortvorteil.
3. Erfolgsfaktoren aus Sicht der Stadtplanung
a) Marktbedürfnisse kennen:
Beispiel: In einer Region mit wachsendem Online-Handel werden Logistikflächen gebraucht. Die Stadt kann gezielt Flächen für diese Nutzung ausweisen.
b) Flexibilität der Flächen:
Beispiel: Ein ehemaliges Fabrikgelände wird so umgestaltet, dass es sowohl für Produktion als auch für Büros oder Start-ups genutzt werden kann.
c) Rechtliche Klarheit schaffen:
Beispiel: Ein Bebauungsplan, der verschiedene Nutzungen zulässt, macht die Fläche für mehr Interessenten attraktiv.
d) Zusammenarbeit fördern:
Beispiel: Die Stadt richtet eine zentrale Anlaufstelle für Investoren ein, um Fragen schnell zu klären und Verfahren zu beschleunigen.
e) Altlasten und Infrastruktur prüfen:
Beispiel: Vor dem Verkauf eines alten Werksgeländes wird eine Altlastenuntersuchung durchgeführt und die Ergebnisse transparent gemacht.
4. Typische Herausforderungen und Lösungsansätze
- Langwierige Verfahren:
Lösung: Frühzeitige Abstimmung zwischen Eigentümer, Stadt und potenziellen Nutzern. - Unklare Nachfrage:
Lösung: Marktanalysen und Gespräche mit Unternehmen helfen, die richtigen Nutzungen zu identifizieren. - Konflikte im Nutzungsmix:
Beispiel: Logistik neben Wohnbebauung kann zu Problemen führen. Hier helfen klare Vorgaben im Bebauungsplan und Pufferzonen.
5. Fazit für Stadtplaner
Die Revitalisierung von Industrieflächen gelingt am besten, wenn Stadt, Eigentümer und Nutzer frühzeitig zusammenarbeiten. Flexible Planung, rechtliche Klarheit und ein offenes Ohr für die Bedürfnisse des Marktes sind der Schlüssel zum Erfolg.
Tipp:
Stadtplaner können durch aktive Moderation und transparente Kommunikation viele Stolpersteine aus dem Weg räumen – und so aus alten Industrieflächen neue Chancen für die Stadt schaffen.
Revitalisierung von Industrie-Standorten für die Verteidigungsindustrie: Leitfaden für Stadtplaner
Die Verteidigungsindustrie steht im Zentrum der aktuellen sicherheitspolitischen Debatte. Die Bundesregierung hat mit der Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie die Bedeutung einer leistungsfähigen, innovativen und resilienten Verteidigungsindustrie betont. Für Stadtplaner ergeben sich daraus besondere Anforderungen bei der Entwicklung und Umnutzung von Industrieflächen.
[bmvg.de]
1. Was erwartet die Verteidigungsindustrie von Standorten?
Praxisbeispiel:
Ein Rüstungsunternehmen sucht kurzfristig eine neue Produktionsstätte für die Fertigung von Schlüsseltechnologien (z.B. Sensorik, KI-gestützte Systeme oder gepanzerte Fahrzeuge). Die Anforderungen sind hoch: Neben ausreichend großen, gesicherten Flächen werden eine leistungsfähige Energieversorgung, Anbindung an Bahn und Straße sowie hohe Sicherheitsstandards benötigt.
Wichtige Punkte für Stadtplaner:
- Schnelle Verfügbarkeit: Die Branche ist auf kurze Realisierungszeiten angewiesen, um auf sicherheitspolitische Entwicklungen reagieren zu können.
- Sicherheitsanforderungen: Flächen müssen für Zugangskontrollen, Werkschutz
und ggf. Geheimschutz geeignet sein. - Infrastruktur: Hohe Anforderungen an Energieversorgung, Telekommunikation, Verkehrsanbindung (auch für Schwertransporte), ggf. Gleisanschluss.
- Flexibilität: Flächen und Gebäude sollten für verschiedene Produktionsprozesse und technologische Innovationen anpassbar sein.
- Genehmigungen: Beschleunigte und transparente Verfahren sind ein Standortvorteil.
2. Was ist bei der Umnutzung von Flächen für die Verteidigungsindustrie besonders zu beachten?
Beispiel:
Ein ehemaliges Industrieareal wird für die Montage von militärischen Fahrzeugen umgenutzt. Die Stadt muss Altlasten prüfen, Lärmschutz sicherstellen und die Ansiedlung mit den Anforderungen an Geheimhaltung und Sicherheit abstimmen.
Wichtige Punkte für Stadtplaner:
- Altlastenmanagement: Frühzeitige Klärung und Sanierung ist entscheidend, da die Verteidigungsindustrie hohe Standards verlangt.
- Nachbarschaft: Konflikte mit sensiblen Nutzungen (z.B. Wohngebiete, Schulen) vermeiden, Pufferzonen einplanen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen: Bebauungspläne müssen sicherstellen, dass verteidigungsindustrielle Nutzung zulässig ist.
- Kommunikation: Transparente Information der Öffentlichkeit, um Akzeptanz zu schaffen.
3. Erfolgsfaktoren für die Standortentwicklung
- Planungssicherheit: Die Verteidigungsindustrie benötigt langfristige Zusagen und stabile Rahmenbedingungen, auch über Legislaturperioden hinweg. [ihk-muenchen.de]
- Innovationsförderung: Flächen sollten für Forschung, Entwicklung und Produktion neuer Technologien geeignet sein (z.B. Testfelder, Labore).
- Kooperation: Zusammenarbeit mit Bund, Land und Wirtschaftsförderung, um Fördermittel und strategische Partnerschaften zu nutzen.
- Fachkräfte: Standortattraktivität für hochqualifizierte Arbeitskräfte (z.B. Nähe zu Hochschulen, gute Erreichbarkeit).
4. Praxisbeispiel: Erfolgreiche Umnutzung
Beispiel:
Ein ehemaliges Werksgelände in Bayern wurde in ein Kompetenzzentrum für Wehrtechnik umgewandelt. Die Stadt hat frühzeitig mit dem Unternehmen, dem Land und der Bundeswehr kooperiert, Altlasten beseitigt, die Infrastruktur modernisiert und einen Bebauungsplan für verteidigungsindustrielle Nutzung geschaffen. Ergebnis: Neue Arbeitsplätze, Stärkung der regionalen Wirtschaft und Beitrag zur nationalen Sicherheit.
5. Fazit für Stadtplaner
Die Revitalisierung von Industrieflächen für die Verteidigungsindustrie erfordert vorausschauende Planung, enge Abstimmung mit allen Beteiligten und die Bereitschaft, besondere Anforderungen zu erfüllen. Wer diese Herausforderungen aktiv angeht, kann seine Kommune als attraktiven und zukunftssicheren Standort für Schlüsselindustrien positionieren.
Tipp:
Nutzen Sie die strategische Bedeutung der Verteidigungsindustrie für Ihre Stadtentwicklung – und schaffen Sie die Voraussetzungen für Innovation, Sicherheit und wirtschaftliche Stärke.
Quellen & weiterführende Informationen:
- Nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie
- Eckpunktepapier für eine moderne Verteidigungsindustrie
- Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie